Filterung im öffentlichen WLAN der Stadt Augsburg
Das Amt für Organisation und Informationstechnik der Stadt Augsburg ist Ansprechpartner für das öffentliche WLAN. Die Nutzungsbedingungen regeln den Einsatz von Filtern bzw. Filtersoftware für rechtswidrige und jugendgefährdende Inhalte.
Ich möchte Sie bitten mir nähere Informationen zum Einsatz der Filtertechnologien zukommen zu lassen.
1.) Wie viele Zugriffe hat das Filtersystem in den Jahren 2014 bis 2018 verhindert, die in die eingestellten Kategorien fielen?
2.) Wie viele Zugriffe, egal ob blockiert oder nicht, wurden vom Filtersystem verarbeitet?
3.) Welchen Anteil, sowohl prozentual als auch absolut, machen die blockierten Zugriffe an der Gesamtzahl aller verarbeiteten Zugriffe aus?
4.) Welche Kategorien sind in der Filtersoftware aktiviert, die zur Verhinderung der Zugriffe führen?
5.) Wie lautet die Produktbezeichnung der Filtersoftware?
6.) Welche jährlichen Gesamtkosten, aufgeschlüsselt pro Jahr zwischen 2014 bis 2018, verursacht der Einsatz der Filtersoftware?
7.) Wer entscheidet über die Aktivierung der jeweiligen Kategorie, die zur Filterung des Zugriffs führt?
8.) Welche alternativen Vorgehensweisen gegenüber der Filterung von Zugriffen, wurden diskutiert, was waren die Pro- und Contra-Argumente und wer traf letztendlich die Entscheidung?
9.) Existiert ein Prüfverfahren, ob die Filterung verhältnismäßig, zielgerichtet und effektiv ist und falls ja, bitte ich im um Darlegung dessen?
Anfrage teilweise erfolgreich
-
Datum2. Mai 2019
-
4. Juni 2019
-
Ein:e Follower:in
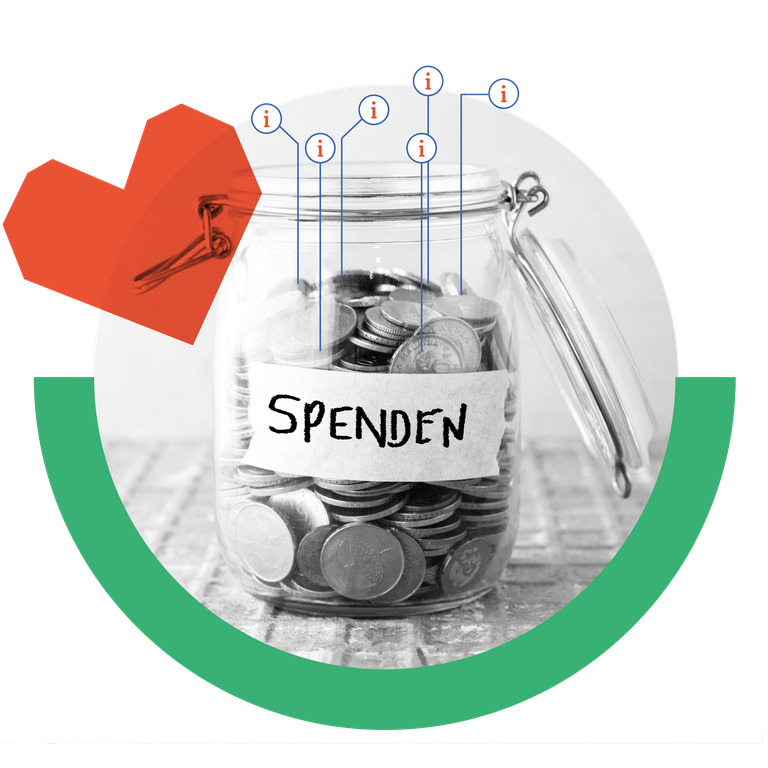
Ein Zeichen für Informationsfreiheit setzen
FragDenStaat ist ein gemeinnütziges Projekt und durch Spenden finanziert. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir die Plattform zur Verfügung stellen und für unsere Nutzer:innen weiterentwickeln. Setzen Sie sich mit uns für Informationsfreiheit ein!