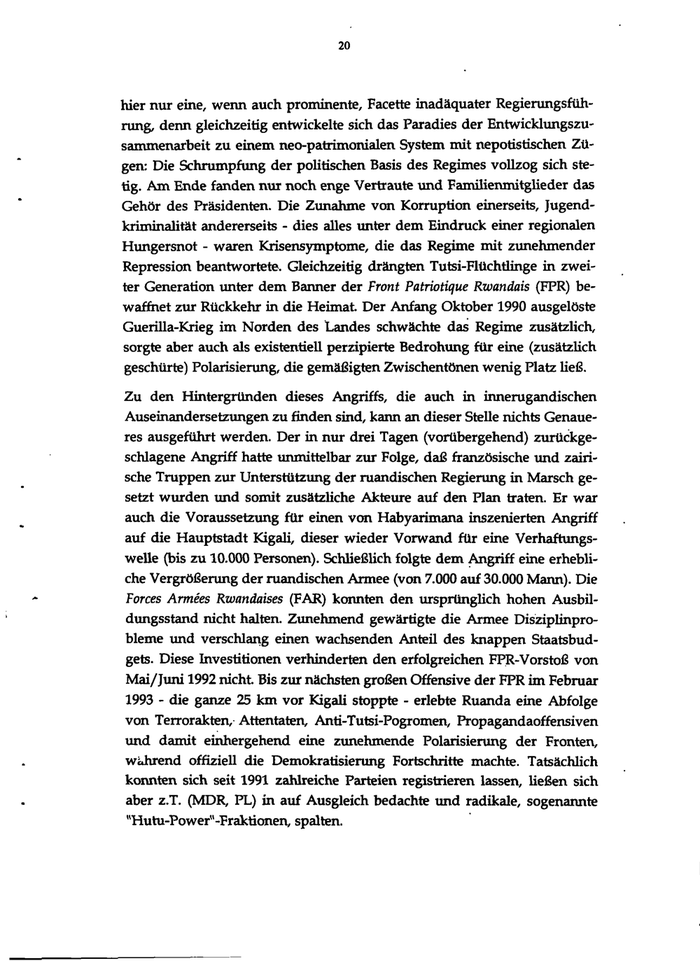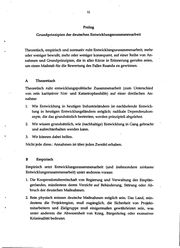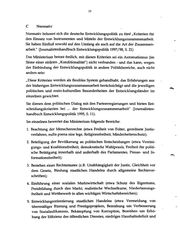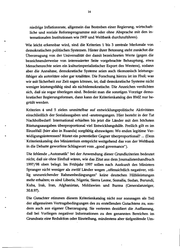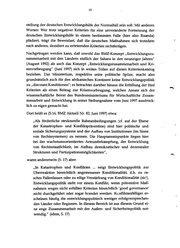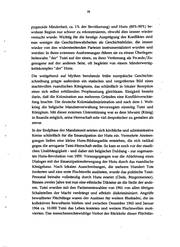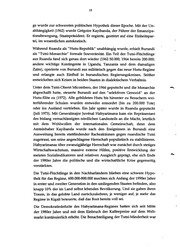Ruanda_Deutsche_Entwicklungszusammenarbeit_Hauptber_2016_0303467.pdf
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Gutachten zu deutscher Entwicklungszusammenarbeit in Ruanda“
11 zu konzentrieren. Die Schwerpunktverlagerung des schweizerischen (aber auch teilweise des US-amerikanischen) Engagements auf den' Bereich „good go- vernance" könnte ein Vorbild abgeben. Damit könnte eine Reduktion des deut- schen Beitrages einhergehen. Es leidet nämlich insgesamt keinen Zweifel, daß die sich verhärtende Politik des Regimes Kagames nur deshalb möglich ist weil ein massiver Ressourcenzufluß vom Ausland erfolgt und dieses minde- stens implizit das mißverständliche Signal aussendet damit werde die Radika- lisierung der Politik gebilligt. Zu den analysierten Einzelprojekten in den Bereichen Bildimg, Reintegration von Rüchüingen, Medien und Justiz sind im Teil IV unter C und D kürzeste Empfehlungen zusammengestellt worden, die eine Wiederholung an dieser Stelle entbehrlich erscheinen lassen (ausführliche Begründüngen im Teil II). Dem Bimdesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick- lung wird darüber hinaus empfohlen, dem in Ruanda problematischen Ver- hältnis zwischen dem Drittmittelgeschäft der GTZ und der oftiziellen deut- schen TZ besondere Aufmerksamkeit zu widmen. - ^
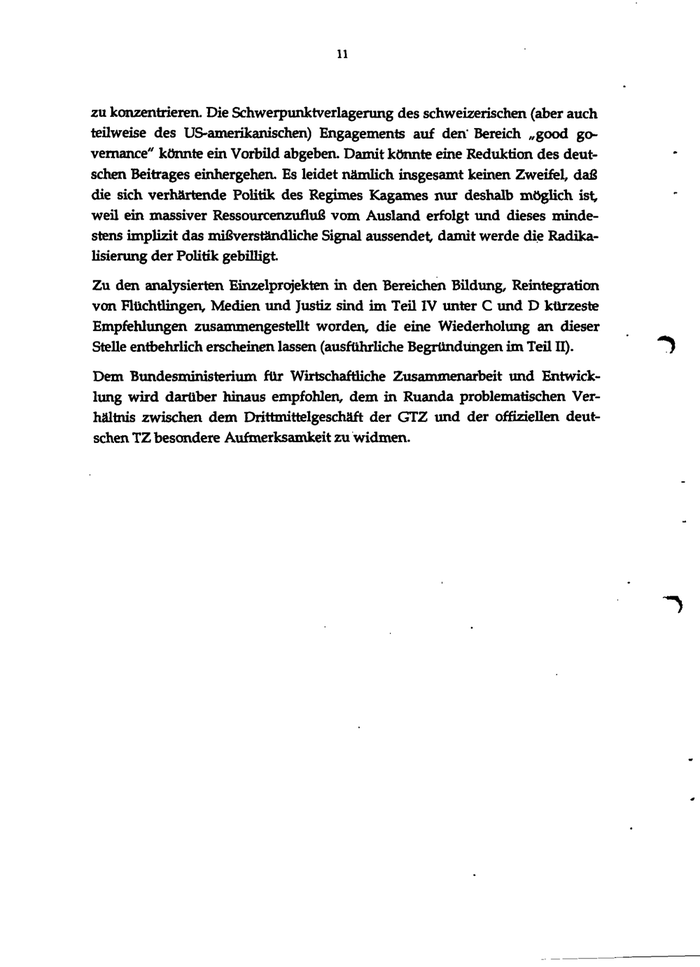
12 Prolog Grundprinzipien der deutschen Entwicklungszusanunenarbeit Theoretisch, empirisch und normativ ruht Entwicklungszusammenarbeit mehr oder weniger bewußt mehr oder weniger konsequent auf einer Reihe von An- nahmen und Grundprinzipien, die in aller Kürze in Erinnerung gerufen seien, um einen Maßstab für die Bewertung des Falles Ruanda zu gewinnen. A Theoretisch Theoretisch ruht entwicklimgspolitische Zusammenarbeit (zum Unterschied von rein karitativer Not- und Katastrophenhilfe) auf einer dreifachen An- nahme: 1. Wie Entwicklung in heutigen Industrieländern ist nachholende Entwick- lung in heutigen Entwicklungsländern möglich; radikale Dependenzkon- zepte, die das grundsätzlich bestreiten, werden prinzipiell abgelehnt 2. Wir wissen grundsätzlich, wie (nachhaltige) Entwicklung in Gang gebracht und aufrechterhalten werden kann. 3. Wir können dabei helfen. Nicht jede diesem Annahmen ist über jeden Zweifel erhaben. B Empirisch Empirisch setzt Entwicklungszusammenarbeit (und insbesondere wirksame Entwicklungszusammenarbeit) unter anderem voraus: 1. Die Kooperationsbereitschaft von Regierung und Verwaltung des Empfän- gerlandes, mindestens deren Verzicht auf Behinderung, Störung oder Ab- bruch der deutschen Meißnahmen. 2. Rein physisch müssen deutsche Maßnahmen möglich sein. Das LcUid, min- destens die Projektregion, muß zugänglich, die Sicherheit von Projekt- mitarbeitem und Zielgruppe muß einigermaßen gewährleistet sein, was unter anderem die Abwesenheit von Krieg, Bürgerkrieg oder exzessiver Kriminalität bedeutet
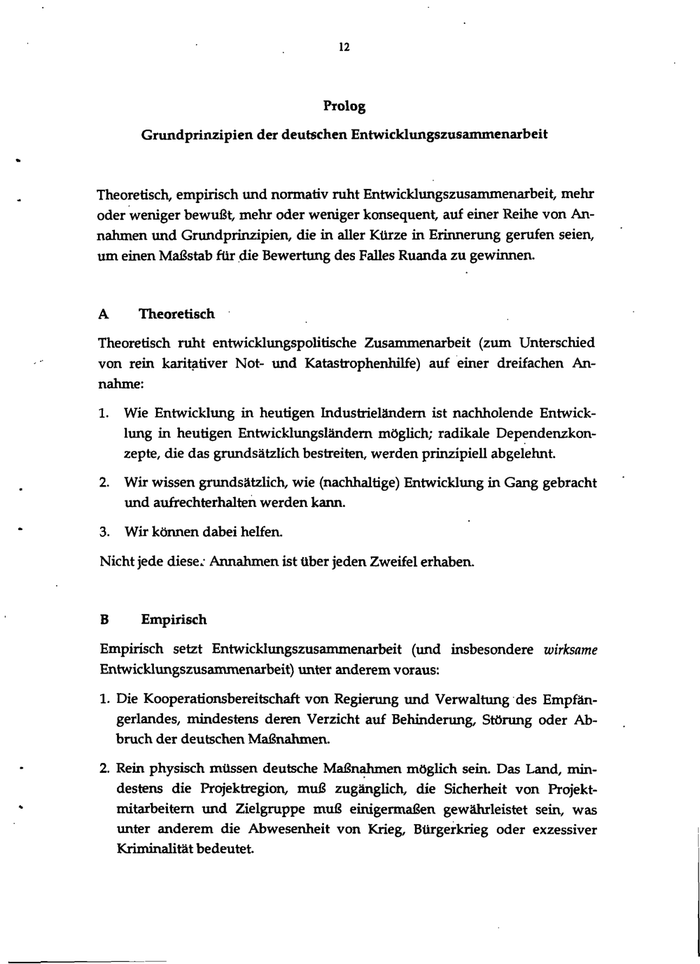
13 C Normativ Normativ bekermt sich die deutsche Entwicklungspolitik zu fünf „Kriterien für den Einsatz von Instrumenten und Mitteln der Entwicklungszusanunenarbeit. Sie haben Einfluß sowohl auf den Umfang als auch auf die Art der Zusammen- arbeit." (Joumalistenhandbuch Entwicklimgspolitik 1997/98, S. 21) Das Ministerium betont freilich, mit diesen Kriterien sei ein Automatismus (im Sirme einer strikten „Konditionalität") nicht verbunden - und das kaim, wegen der Einbindung der Entwicklungspolitik in andere Politikbereiche, auch nicht anders sein: „Diese Kriterien werden als flexibles System gehandhabt das Erfahrungen aus der bisherigen Entwicklungszusammenarbeit berücksichtigt und die jeweiligen politischen und sozio-kulturellen Besonderheiten der Entwicklungsländer im einzelnen gewichtet. Sie dienen dem politischen Dialog mit den Partnerregierungen und bieten Ent- scheidungskriterien bei ... der Entwicklungszusammenarbeit" (Joumalisten- handbuch Entwicklungspolitik 1995, S. 11). Im einzelnen bewertet das Ministerium folgende Bereiche: 1. Beachtung der Menschenrechte (etwa Freiheit von Folter, geordnete Justiz- verfahren, nulla poena sine lege, Religionsfreiheit Minderheitenschutz); 2. Beteiligung der Bevölkerung an politischen Entscheidungen (etwa Vereini- gungs- und Koalitionsfreiheit demokratische Wahlpraxis, Freiheit für politi- sche Betätigung innerhalb und außerhalb des Parlamentes, Presse- und In- formationsfreiheit); 3. Bestehen eines Rechtsstaates (z.B. Unabhängigkeit der Justiz, Gleichheit vor dem Gesetz, Bindung staatiichen Handelns durch allgemeine Rechtsvor- schriften); 4. Einführung einer sozialen Marktwirtschaft (etwa Schutz des Eigentums, Preisbildung durch den Markt realistische Wechselkurse, Niederlassungs- freiheit und Wettbewerb in allen wichtigen Wirtschaftsbereichen); 5. Entwicklungsorientierung staatiichen Handelns (etwa Vermeidung von übermäßiger Rüstung und Prestigeprojeken, Bemühung um Verbesserung von Sozialindikatoren, Bekämpfung von Korruption, Bemühen um Erhö- hung der Effizienz des öffentiichen Dienstes, niedriges Haushaltsdefizit und
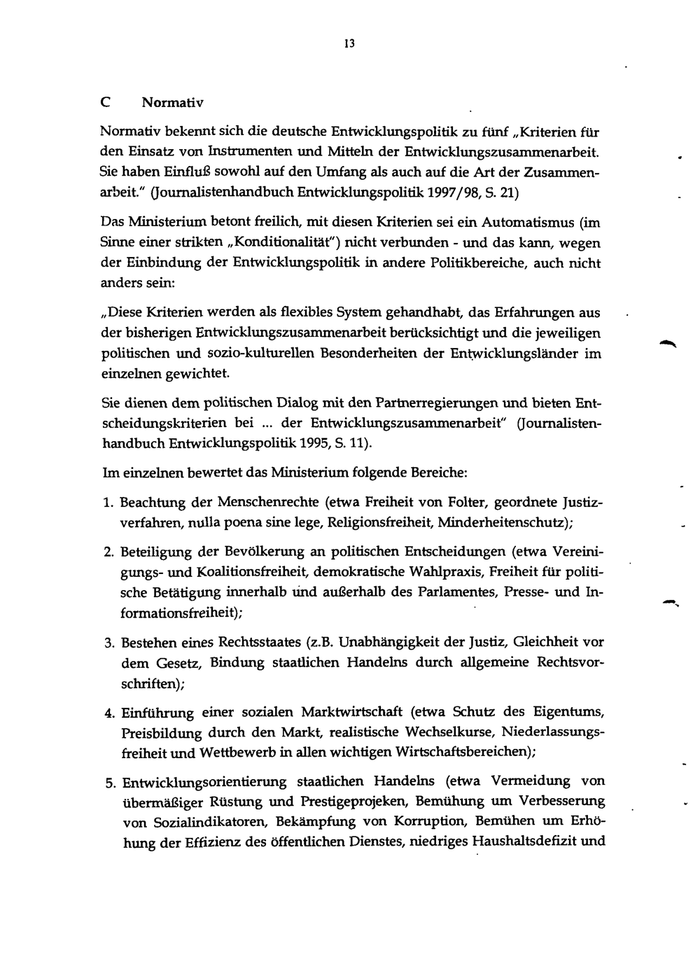
14 niedrige Inflationsrate, allgemein das Bestreben einer Regienmg, wirtschaft- liche und soziale Reformprogramme mit oder ohne Absprache mit den in- temationalen Institutionen wie IWF und Weltbank durchzuführen). Wie leicht erkennbar wird, sind die Kriterien 1 bis 3 zentrale Merkmale von demokratischen politischen Systemen. Hinter ihrer Betonung steht zunächst die Überzeugung von der Universalität der damit bezeichneten Werte (gegen die bezeichnenderweise von interessierter Seite vorgebrachte Behauptung, etwa Menschenrechte seien ein kulturimperialistischer Export des Westens), sodann aber die Annahme, demokratische Systeme seien auch ökonomisch leistungs- fähiger als autoritäre oder gar totalitäre. Die Forschung hierzu ist im Fluß; was wir mit Sicherheit zur Zeit sagen können, ist daß demokratische Systeme nicht weniger leistungsfähig sind als nichtdemokratische. Die Anzeichen verdichten sich, daß sie sogar überlegen sind. Bedenkt man die sonstigen Vorzüge demo- kratischer Regierungsformen, dann kann der Kriterienkatalog des BMZ nur be- grüßt werden. Kriterien 4 und 5 zielen unmittelbar auf entwicklungspolitische Aktivitäten einschließlich der Sozialausgaben und -anstrengimgen. Hier besteht in der Tat Nachholbedarf: International erhielten bis jetzt die Länder mit den höchsten Rüstungsausgaben überproportional viel Entwicklungshilfe. Freilich gilt es im Einzelfall (hier also in Ruanda) sorgfältig abzuwägen: Wo enden legitime Ver- teidigungsinteressen? Rüstet ein potentieller Gegner überproportional? ... (Dem Kriterienkatalog des Miiüsterium entspricht weitgehend das von der Weltbank in die Debatte geworfene Schlagwort vom „good governance"). Die fehlende „Automatik" bei der Anwendung dieser Grundkriterien bedeutet nicht daß sie ohne Einfluß wären, wie das Zitat aus dem Joumalistenhandbuch 1997/98 oben belegt. Im Frühjahr 1997 sollen nach Auskunft des Ministers Spranger nicht weniger als zwölf Länder wegen „offensichtiich negativer, völ- lig unzureichender Rahmenbedingungen" keine deutschen Hilfsleistungen mehr erhalten; es sind Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Burundi, Kuba, Irak, Iran, Afghanistan, Moldawien und Burma (Generalanzeiger, 30.8.97). Die Gutachter stimmen diesem Kriterienkatalog nicht nur sozusagen als Teil der allgemeinen Vertragsbedingungen des zu erstellenden Gutachtens zu, son- dern auch aus eigener Überzeugung. Sie vertreten dezidiert die Auffassung, daß bei Vorliegen negativer Informationen zu den genarmten Bereichen im Grundsatz eine Reduktion oder Einstellung, mindestens aber tiefgreifende Um-
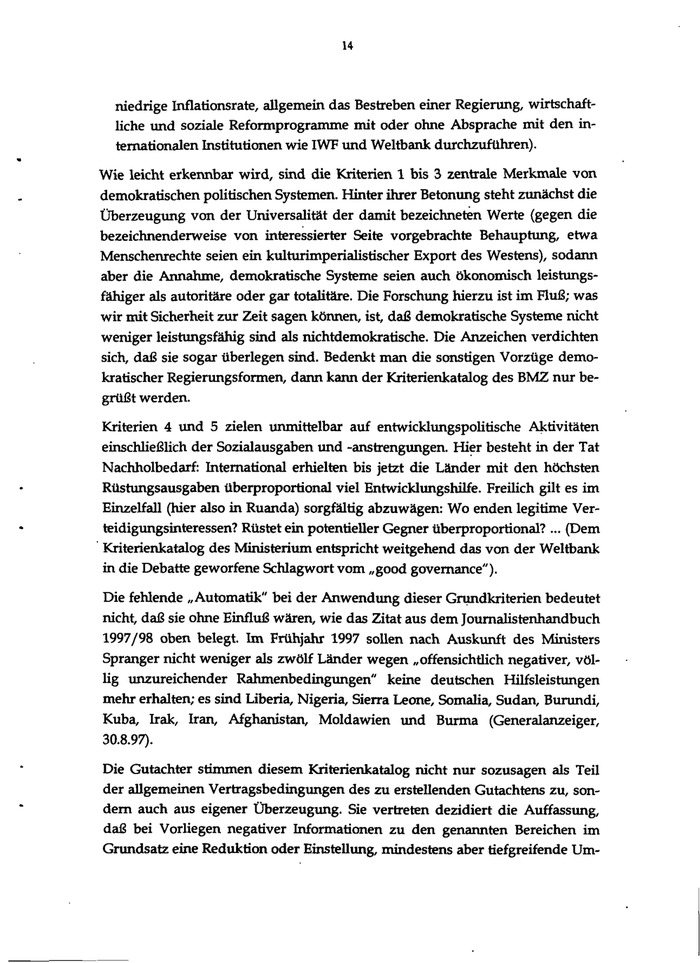
15 Stellung der deutschen Entwicklungshilfe der Normalfall sein soll. Mit anderen Worten: Wer trotz negativer Kriterien für eine unveränderte Fortsetzung der deutschen Entwicklungshilfe in einem bestimmten Falle (hier also Ruanda) plädiert trägt die Beweislast daß die deutschen Maßnahmen sich trotzdem nach anderen, dezidiert zu erörternden Kriterien rechtfertigen. Nachgetragen werden kann, daß sowohl das BMZ-Konzept „Entwicklungszu- sammenarbeit mit den Ländern südlich der Sahara in den neunziger Jahren" (August 1992) als auch das Konzept „Entwicklungszusammenarbeit und Kri- senvorbeugung" (Juni 1997) sich in weiten Teilen auf diesen Kriterienkatalog beziehen. Das Ministerium, respektive seine politische • Spitze, macht also grundsätzlich auch für den afrikanischen Kontinent keine Entwicklungspolitik zu „discount-Konditionen"; es betrachtet darüber hinaus die Erfüllung der fünf Kriterien als einen Beitrag zur Krisenvorbeugung, welchen Ansatz sich der wissenschcifüiche Beirat des Bundesministeriums für Wirtschafüiche Zusam- menarbeit und Entwicklung in seiner Stellungnahme vom Juni 1997 ausdrück- lich zu eigen gemacht hat. Dort heißt es (S.16, BMZ Aktuell Nr. 82, Juni 1997) etwa: „Als förderliche strukturelle Rahmenbedingungen (cf. auf der Ebene der Katastrophen- und Konfliktprävention) sind hier politische und soziale Sicherungssysteme und der Aufbau von Institutionen (im Sinne, von Rechtssystemen) zu nennen. Die Hauptansatzpunkte liegen hier bei der wachstumsorientierten Armutsbekämpfung, der Entwicklung von Rechtsstaatiichkeit im Aufbau demokratischer und dezentraler Strukturen und Partizipationsmöglichkeiten", warnt andererseits (S. 17) aber: „In Katastrophen und Konflikten ... neigt Entwicklungspolitik zur Überreaktion hinsichtiich angemessener Konditionalität d.h. zu ra- sches Fallenlassen oder zu eilige Verstärkung von Konditionalität (sie!). Entwicklungspolitik steht vor einem Konflikt wenn präventive Maß- nahmen wegen nicht erfüllter Kriterien hinsichtiich 'good governance' nicht durchgeführt oder sogar beendet werden. Kcnfliktanfälliger er- seheinen häufig die entwicklungspolitisch weniger erfolgversprechen- den Länder oder Regionen. In diesem Bereich ist aus diesem Grund ei- ne enge Zuscunmenarbeit mit der Außen- und Sieherheitspolitik not- wendig." (idem, S. 17)
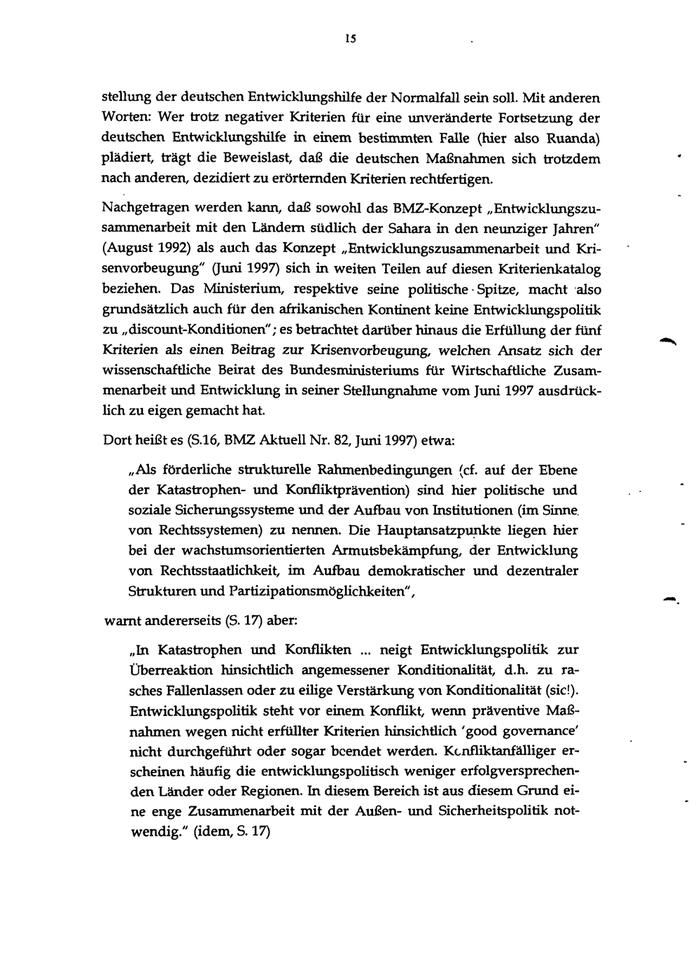
16 Kritisch sei hinzugefügt daß die neuere Forschung zu Kriegs- und Konfliktur- sachen die früher als selbstverständheh betrachtete Kausalität (von ungerechten Sozialverhältnissen über soziale Spannungen zu - auch bewaffneten - Konflik- ten) weitgehend hinter sieh gelassen hat. Die Ursachen der zahlreichen Konflik- te in der Welt sind keineswegs auf Sozialprobleme zu reduzieren. Wie zu erör- tern sein wird, ist auch Ruanda nicht mit einem glatten Nexus Sozialkonflikt- Krise-Völkermord-Militärherrschaft zu fassen.
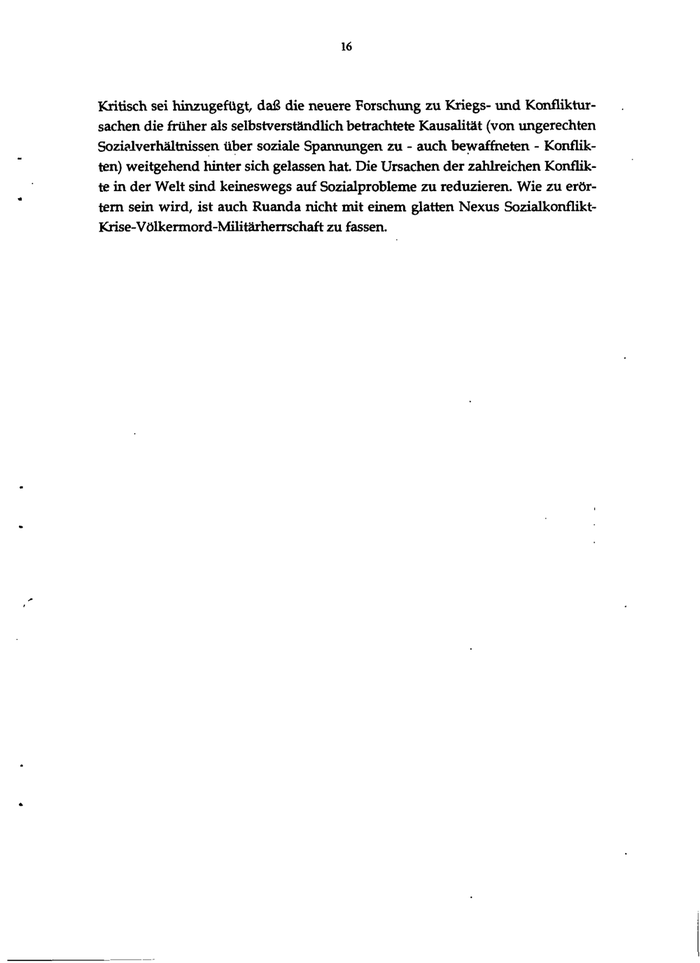
17 I. Der R a h m e n : R u a n d a in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre A Genese der gegenwärtigen Situation Ruanda befindet sieh in einem unerklärten Kriegszustand, der momentan ein Drittel seiner Fläche betrifft. Die Hintergründe des Konfliktes sind in der Geschichte verankert und lassen sich nicht allein auf die allenthalben bekannten Ereignisse des Jahres 1994 reduzieren. Dermoch handelt es sich um einen vollständig modernen Konflikt - auf Eliteebene um Macht und Pfründen, auf breiterer Ebene um die Ansprüche Vertriebener verschiede- ner Epochen (vornehmlich auf Rückkehrrecht und Land) und auf ideologi- scher Ebene um die Auseinandersezimg zwischen Anhängern verschiede- ner Geschiehtsinterpretationen. Von Bedeutung ist auch die regionale Ein- bettung dieses Konflikts in eine Zone der Instabilität Wissenschaftiiehe Interpretationen des Konflikts variieren zum Teil erheb- lich. In recht entscheidenden Fragen gibt es divergierende Einschätzungen, z.B. hinsichtiich der Gewichtung und Erklärung der ethnischen Frontstel- lung ganz allgemein oder etwa gegenüber der Verantwortung für das Schlüsselereignis am 6.4.1994 (Abschuß der Maschine Habyarimanas). Zweifellos aber hat die heute sehr eindeutige Frontstellung zwischen Hutu und Tutsi historische Wurzeln, darunter einige, die in die Vorkolonialzeit zurückreichen - ohne daß diese die Eskalation erklären körmten. Hier ist vor allem die soziale Rangordnung zwischen den beiden Bevölkerungs- gruppen zu nennen, die sich - wenn auch nicht landesweit - in einer Art "Lehensverhältnis" wiederspiegelte, das zum Teil ausbeuterische Züge trug; keinesfalls traf der Begriff "Stamm" aber als Beschreibung der in ge- genseitiger Abhängigkeit lebenden Bevölkerungsteile zu. Die Zugehörig- keit zu einem Clan und zu territorialen Einheiten waren noch in frühkolo- nialer Zeit mindestens ebenso wichtige identitätsstiftende Momente wie die ethnische Kategorisierung. Es ist bekannt daß es zu jeder Zeit auch reiche Hutu und arme Tutsi gab, so daß soziale und ethnische Zugehörigkeit nicht vollständig deckungsgleich waren. Unbestritten ist auch das bereits früh vorhandene hohe Maß an sozialer Kontrolle und eine dazugehörige Über- reaktion des politischen Systems, wann auch immer ein Kontrollverlust drohte. Demgegenüber sind die Modalitäten und Zeiträume der zuvor er- folgenden Zuwanderung von Tutsi (heute 9%-20%) in eine von Twa (eine
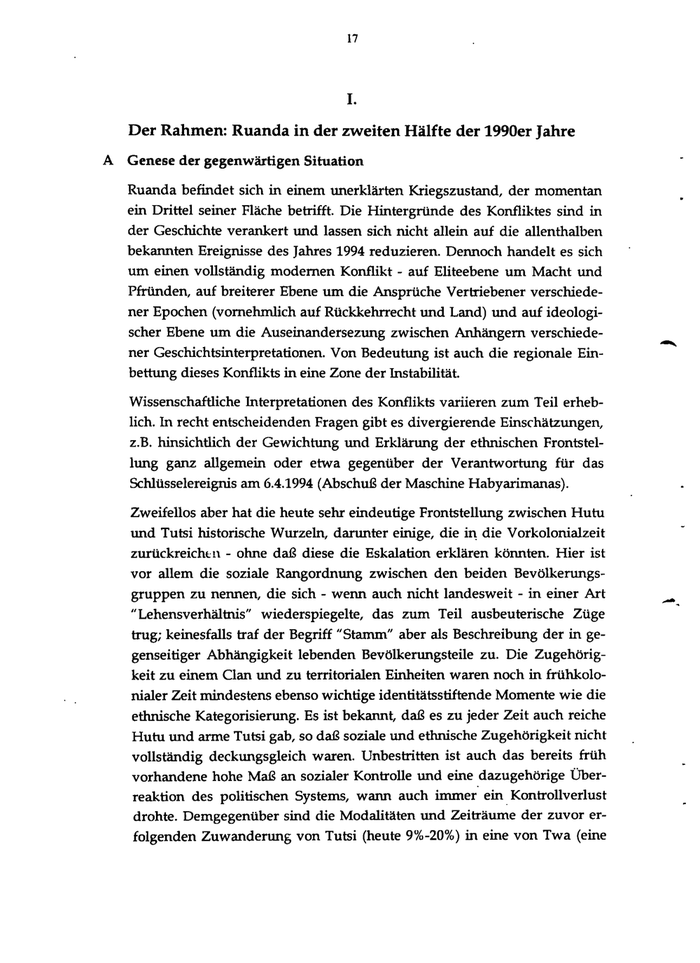
18 pygmoide Minderheit ca. 1% der Bevölkerung) und Hutu (80%-90%) be- wohnte Region nur schwer zu rekonstruieren, obwohl dies immer wieder versucht wurde. Wichtig für die heutige Ausprägung" des Konfliktes sind nun weniger die Geschichtswahrheiten als Geschichtsbilder, die immer wieder von den widerstreitenden Parteien instrumentalisiert wurden und werden: In ihren extremen Ausformungen führen sie zu einem Überlegen- heitswahn "der" Tutsi auf der einen, zu ihrer Verfemimg als Frtmde/Zu- gezogene auf der anderen Seite, oft begleitet von einem Minderwertig- keitskomplex "der" Hutu. Die weitgehend auf Mythen beruhende frühe europäische Geschichts- schreibung prägte außerdem ein statisches und vergröbertes Bild eines machtvollen ruandischen Königtums, das schließlich in lokaler Rezeption einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung gleichkam. Einigkeit besteht darin, daß die Kolonisation aus mehreren Gründen eine Konfliktverschär- fung brachte. Die deutsche Kolonialadministration und nach dem I. Welt- krieg die belgische Mandatsverwaltung bevorzugten einseitig Tutsi und Königtum. Mit dieser extemen Unterstützung war es dem Mwami (König) in Ruanda möglich, seine Herrrschaft sehr viel despotischer zu gestalten als zuvor. In der Endphase der Mandatszeit setzten sich kirchhche und administrative Kreise schließlich für die Emanzipation der Hutu ein. Vermehrte Anstren- gungen ließen eine kleine Hutu-Bildungselite entstehen, die sich radikal gegen die arrogante Tutsi-Herrschaft stellte. So kam es noch vor der staatii- chen Unabhängigkeit - und daher mit belgischer Duldung - zur sogenann- ten Hutu-Revolution von 1959. Vorausgegangen war die Ablehnimg eines Dialoges mit der Emanzipationsbewegung der Hutu durch das ruandische Königshaus. Nach lokalen Ausschreitungen, die mehrere Hundert Tote forderten und eine erste Fluchtwelle auslösten, wurde das politische Tutsi- Personal beinahe vollständig durch Hutu ersetzt (Chefs, Bürgermeister). Binnen zweier Jahre trat nun eine ethnische Diktatur an die Stelle der ande- ren. Tutsi wurden mit den Parlamentswahlen von 1961 von allen übrigen Schaltstellen der Macht verdrängt und effektiv diskrimininiert. Angriffe bewaffneter Flüchtiinge waren der Auslöser für weitere Blutbäder, die im kollektiven Bewußtsein blieben und zwischen Dezember 1963 und Januar 1964 ca. 10.000 Tutsi das Leben kosteten und weitere Fluchtwellen moti- vierten. Das menschenrechtswidrige Verbot der Rückkehr dieser Flüchtiin-
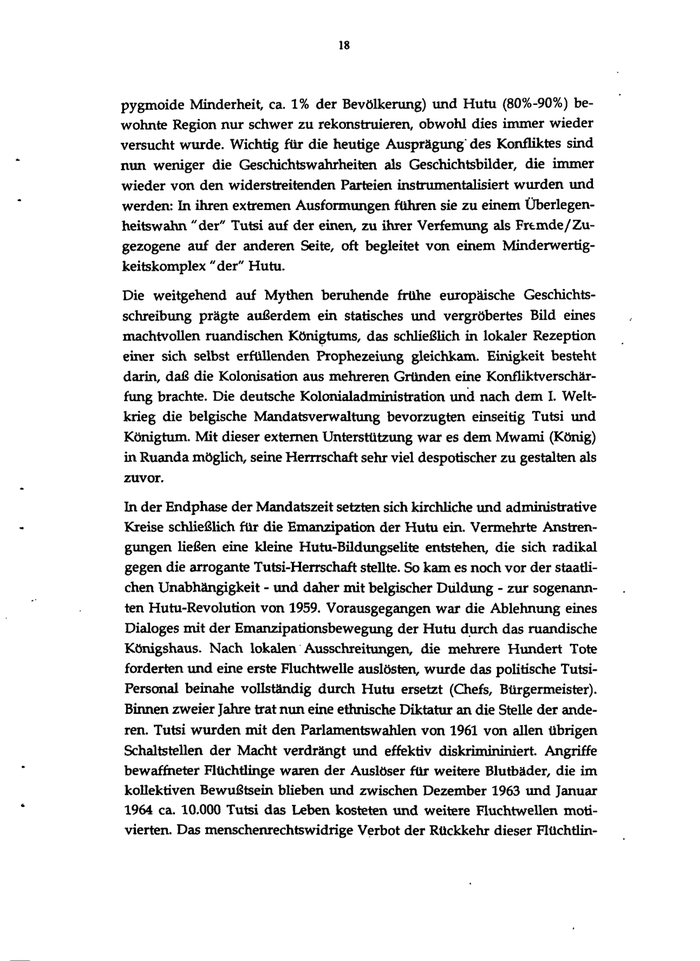
19 ge wurde zur schwersten politischen Hypothek dieser Epoche. Mit der Un- abhängigkeit (1962) wurde Grégoire Kayibanda, der Führer der Emanzipa- tionsbewegung, Staatspräsident Er regierte, gestützt auf eine Einheitspar- tei, im wesentiichen autokratisch. Während Ruanda als "Hutu-Republik" unabhängig wurde, erhielt Burundi als "Tutsi-Monarchie" formale Souveränität. Ein Teil der Tutsi-Flüchtiinge aus Ruanda fand sich genau dort wieder (1962 50.000,1964 bereits 200.000; andere wichtige Kontingente in Uganda, Tanzania und dem damaligen Zaïre), operierte von Burundi aus militärisch gegen das neue Hutu-Regime und erlangte auch Einfluß in burundischen Regierungskreisen. Seither entwickelten sich Krisen in beiden Staaten in dialektischem Verhältnis. Unter dem Tutsi-Oberst Micombero, der 1966 geputscht und die Monarchie abgeschafft hatte, steuerte Burundi auf den "selektiven Genozid" an der Hutu-Elite zu (1972). Alle gebildeten Hutu bis hinunter zu Besuchern wei- terführender Schulen wurden entweder ermordet (bis zu 200.000 Tote) oder ins Ausland vertrieben. Ein Jahr später wurde in Ruanda geputscht 0uli 1973). Mit Generalmajor Juvenal Habyarimana kam ein Repräsentant des bislang vernachlässigten nördlichen Landesteils an die Macht letzüich mit dem Wohlwollen der intemationalen Gemeinschaft denn dem Amtsinhaber Kayibanda wurde nach den Ereignissen in Burundi eine Ausweitung bereits stattfindender Racheaktionen gegen ruandische Tutsi zugetraut um seine angeschlagene Herrschaft populistisch zu stabilisieren. Habyarimanas über zwanzigjährige Herrschaft war zunächst durch stetiges Wirtschaftswachstum, massive externe Hilfen, positive Entwicklung der meisten Sozialindikatoren und relativen Ausgleich geprägt ehe sich Ende der 1980er Jahre die politische und die wirtschafüiche Krise gegenseitig verstärkten. Die Tutsi-Flüchtiinge in den Nachbarländern blieben eine schwere Hypo- tiiek für das Regime, 600.000-800.000 mochten sich Anfang der 1990er Jahre in erster und zweiter Generation in den umliegenden Staaten befinden, also knapp 10% der im Land selbst lebenden Bevölkerung. Und sie gaben ihren Traum, in das gelobte Land zurückzukehren, je weniger aut je mehr das Regime in Kigali beteuerte, daß das Boot bereits voll sei. Die Demokratiedefizite des Habyarimana-Regimes hatten sich seit Mitte der 1980er Jahre und mit dem Einbmch der Kaffeepreise auf dem Welt- markt kontinuierlich erhöht Die Benachteiligung der Tutsi-Minderheit war
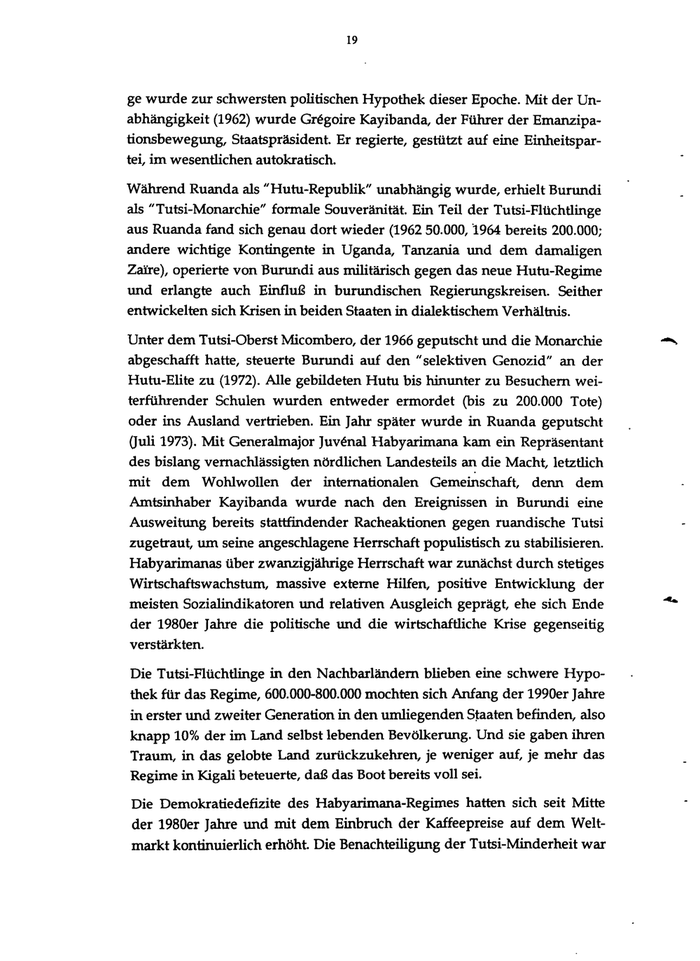
20 hier nur eine, wenn auch prominente, Facette inadäquater Regierungsfüh- rung, denn gleichzeitig entwickelte sich das Paradies der Entwicklungszu- sammenarbeit zu einem neo-patrimoniailen System mit nepotistischen Zu- gen: Die Schrumpfung der politischen Basis des Regimes vollzog sich ste- tig. Am Ende fanden nur noch enge Vertraute und Familienmitglieder das Gehör des Präsidenten. Die Zunahme von Korruption einerseits, Jugend- kriminalität andererseits - dies alles unter dem Eindruck einer regionalen Hungersnot - waren Krisens5anptome, die das Regime mit zunehmender Repression beantwortete. Gleichzeitig drängten Tutsi-Flüchtiinge in zwei- ter Generation unter dem Banner der Front Patriotique Rwandais (FPR) be- waffnet zur Rückkehr in die Heimat Der Anfang Oktober 1990 ausgelöste Guerilla-Krieg im Norden des Landes schwächte das Regime zusätzlich, sorgte aber auch als existentiell perzipierte Bedrohung für eine (zusätzlich geschürte) Polarisierung, die gemäßigten Zwischentönen wenig Platz ließ. Zu den Hintergründen dieses Angriffs, die auch in innerugandischen Auseinandersetzungen zu finden sind, kann an dieser Stelle nichts Genaue- res ausgeführt werden. Der in nur drei Tagen (vorübergehend) zurückge- schlagene Angriff hatte unmittelbar zur Folge, daß französische und zairi- sche Truppen zur Unterstützung der ruandischen Regierung in Marsch ge- setzt wurden und somit zusätzliche Akteure auf den Plan traten. Er war auch die Voraussetzung für einen von Habyarimana inszenierten Angriff auf die Hauptstadt Kigali, dieser wieder Vorwand für eine Verhaftungs- welle (bis zu 10.000 Personen). Schließlich folgte dem Angriff eine erhebli- che Vergrößerung der ruandischen Armee (von 7.000 auf 30.000 Mann). Die Forces Armées Rwandaises (FAR) konnten den ursprünglich hohen Ausbil- dungsstand nicht hedten. Zunehmend gewärtigte die Armee Disziplinpro- bleme und verschlaiig einen wachsenden Anteil des knappen Staatsbud- gets. Diese Investitionen verhinderten den erfolgreichen FPR-Vorstoß von Mai/Juni 1992 nicht Bis zur nächsten großen Offensive der FPR im Februar 1993 - die ganze 25 km vor Kigali stoppte - erlebte Ruanda eine Abfolge von Terrorakten, Attentaten, Anti-Tutsi-Pogromen, Propagandaoffensiven und damit einhergehend eine zunehmende Polarisierung der Fronten, wèihrend offiziell die Demokratisierung Fortschritte machte. Tatsächlich konnten sich seit 1991 zahlreiche Parteien registrieren lassen, ließen sich aber z.T. (MDR, PL) in auf Ausgleich bedachte und radikale, sogenannte "Hutu-Power"-Fraktionen, spalten.