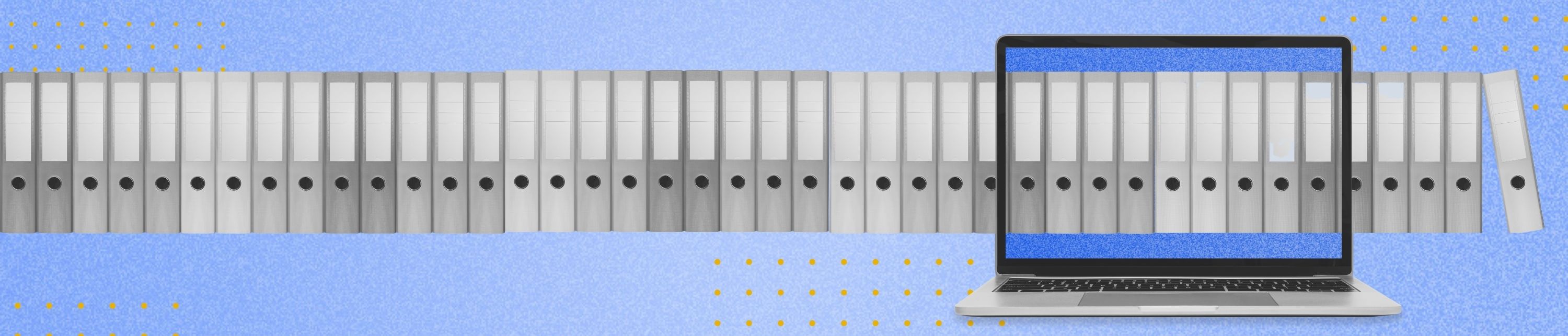
Informationsfreiheit gebündelt, verschlagwortet und digitalisiert.
Die Entscheidungsdatenbank setzt Rechtssprechung in den Fokus und ermöglicht fundierte Recherchen zu aktuellen und vergangenen Urteilen und Entscheidungen rundum Informationsfreiheit.

Aktives Presserecht – Argumente für Auskünfte
Oft verweigern Behörden Auskünfte auf Anfragen von Journalist*innen. Sie berufen sich dabei in der Regel auf angebliche Ausnahmen nach den jeweils gültigen Landespressegesetzen. Häufig ist Unwissen der Grund für die Auskunftsverweigerung und nicht böser Wille. Als Teil des Projektes „Fragen und Antworten - Auskunftsrechte kennen und nutzen“, einer Kooperation mit Netzwerk Recherche, stärkt die Entscheidungsdatenbank das Wissen rundum Auskunftsrechte und hilft besser argumentieren zu können. Journalist*innen können für ihre Recherchen wichtige Urteile, Bescheide und Beschlüsse kostenlos im Volltext eingesehen und durchsuchen.
Information
- Aktenzeichen
- 6 A 269/04
- Datum
- 7. September 2005
- Gericht
- Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht
- Gesetz
- Informationszugangsgesetz Schleswig-Holstein (IZG-SH)
Urteil: Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht am 7. September 2005
6 A 269/04
Eine juristische Person des Privatrechts steht nur dann einer Behörde gleich, wenn sie eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt und dabei öffentlich-rechtlich handelt. Dies gilt auch im Falle der Annahme eines öffentlichen Zwecks bzw. eines wichtigen Interesses an der Gründung eines privatrechtlich organisierten Unternehmens durch eine Stadt. (Quelle: LDA Brandenburg)
Anonymisierung aktualisiert am: 29. März 2012 SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES VERWALTUNGSGERICHT x = Az.: 6 A 269/04 IM NAMEN DES VOLKES URTEIL In der Verwaltungsrechtssache des Herrn A,, A-Straße, A-Stadt Kläger, Proz.-Bev.: Rechtsanwälte Dr. B., B-Straße, B-Stadt, - - gegen die Stadt Norderstedt - Der Oberbürgermeister -, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt Beklagte, Proz.-Bev.: Rechtsanwälte C., C-Straße, C-Stadt, - - Beigeladen: Firma D., D-Straße, A-Stadt Proz.-Bev. :1. Rechtsanwälte C., C-Straße, C-Stadt
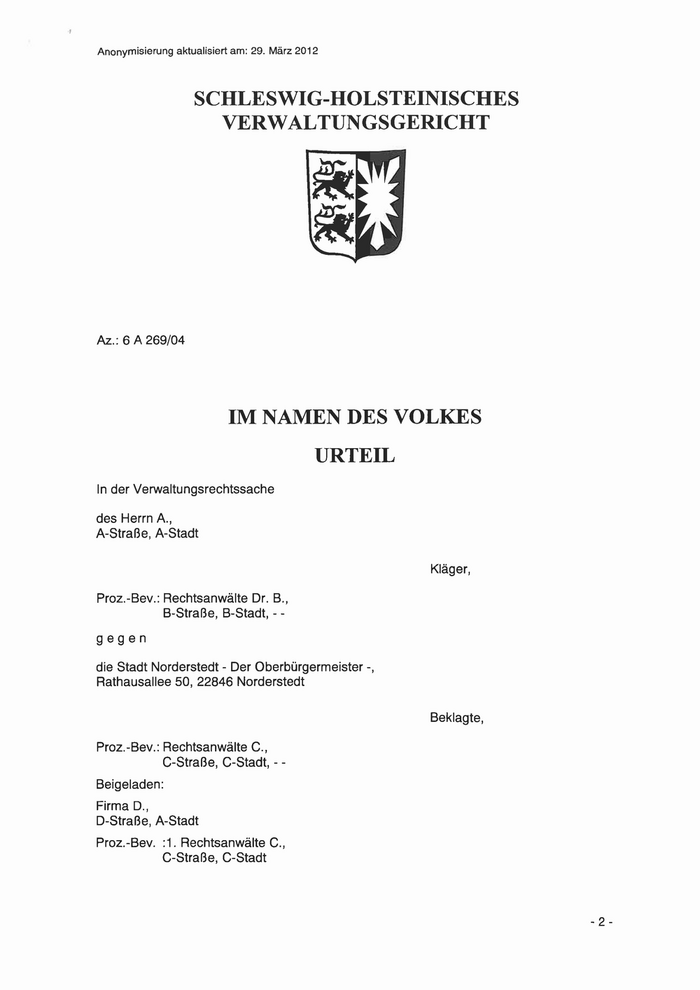
-2- 2. Prof. Dr. F. - Christian-Albrechts-Universität zu B-Stadt -, , F-Straße, B-Stadt Streitgegenstand: Erteilung von Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz hat das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht - 6. Kammer - auf die mündliche Verhandlung vom 7. September 2005 durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsge- richt xxx, den Richter am Verwaltungsgericht xxx, den Richter am Verwaltungsgericht xxx sowie die ehrenamtlichen Richter xxx und xxx für Recht erkannt: Die Klage wird abgewiesen. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. Die außergerichtli- chen Kosten der Beigeladenen sind in Höhe der Aufwendungen eines Rechtsanwaltes nach dem Rechtsanwaltsvergütungsge- setz erstattungsfähig. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar nach Maßgabe der 88 708 Nr. 11, 711 ZPO. Die Berufung wird zugelassen. Tatbestand Die Beteiligten streiten um den Zugang zu Informationen nach dem Informationsfreiheits- gesetz. Der Kläger wandte sich mit Schreiben vom 8. September 2003 an die Beklagte und be- gehrte u.a. Informationen über die geschäftlichen und vertraglichen Beziehungen der Bei- geladenen zu dem privaten Rundfunksender noa4. Der Kläger wollte u.a. wissen, in wel- cher Höhe die Beigeladene Werbeleistungen kaufe; ob es vertragliche Beziehungen gäbe, welche dem Rundfunksender Werbeeinnahmen vertraglich sichere; ob die Beigeladene erworbene Werbeleistungen unentgeltlich an Kunden weitergebe; ob die Beigeladene Werbezeiten des Rundfunksenders vertreibe oder vergüte; ob die Beigeladene im Übrigen den Rundfunksender unterstütze. Wegen des genauen Inhalts dieser und weiterer Fragen wird auf das Schreiben des Klägers vom 8. September 2003 sowie den Schriftsatz des Klägers im verwaltungsgerichtlichen Verfahren vom 5.9.2005 Bezug genommen.
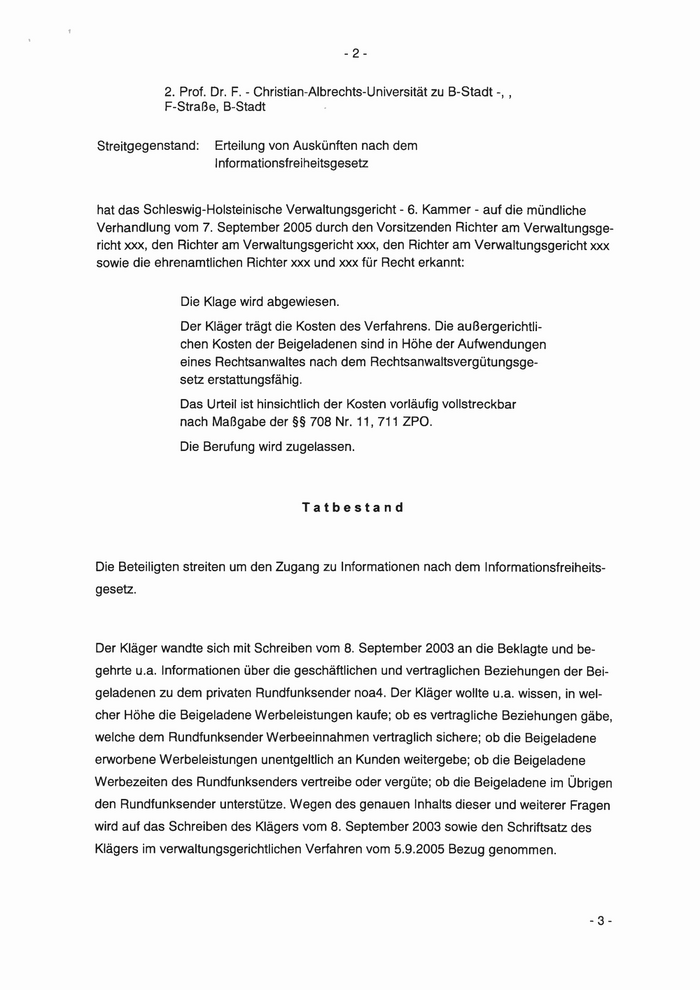
go Bei der Beigeladenen handelt es sich um eine GmbH. Gegenstand des Unternehmens sind ausweislich $ 2 des Gesellschaftsvertrages der städtische Teilnehmernetzbetrieb sowie der Verbindungsnetzbetrieb zum Zwecke der Sprach- und Datenübertragung, der Fernseh- und Rundfunkübertragung, der Betrieb eines Mobilfunknetzes sowie das Ange- bot von Diensten und Informationstechnikservices. Die Beklagte errichtete diese Gesell- schaft und ist einzige Gesellschafterin. Mit Schreiben vom 6.11.2003 wies die Beklagte darauf hin, dass sie nicht verpflichtet sei, Auskünfte über die Beigeladene zu erteilen. Das Informationsfreiheitsgesetz sei nicht an- wendbar, weil die Beigeladene keine öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausübe. Dagegen legte der Kläger mit Schreiben vom 5.12.2003 Widerspruch ein. Er machte gel- tend, dass es nicht darauf ankommen könne, ob sich die Beklagte zur Erfüllung ihrer Auf- gaben der öffentlich-rechtlichen oder der privat-rechtlichen Organisationsform bediene. Die Beklagte sei alleinige Gesellschafterin der Beigeladenen. Durch die Beigeladene be- treibe die Beklagte Öffentliche Daseinsvorsorge. Insoweit sei die Beklagte wie bei einem Eigenbetrieb verpflichtet, die begehrten Auskünfte zu erteilen. Der Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 8.6.2004 zurückgewiesen. Darin heißt es, dass die von dem Kläger begehrten Auskünfte nicht die Ausübung der öffentli- chen Verwaltungstätigkeit betreffe. Das Informationsfreiheitsgesetz sei deshalb nicht an- wendbar. Auch der Umstand, dass die Beklagte alleinige Gesellschafterin sei, führe nicht dazu, dass die Beigeladene öffentlich-rechtlich handele. Die Beigeladene sei privatwirt- schaftlich organisiert und handele dementsprechend ausschließlich privat-rechtlich. Am 21. Juli 2004 hat der Kläger Klage erhoben. Er macht geltend, dass der Auskunftsan- spruch nach dem Informationsfreiheitsgesetz nicht auf öffentlich-rechtliches Handeln be- schränkt sei, sondern auch privatrechtliches Handeln einer Behörde umfasse. Einer Ge- meinde stehe es grundsätzlich frei, zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf eine privatrechtliche Organisations- und Handlungsform zurückzugreifen. Dies dürfe aber nicht dazu führen, dass das Informationsfreiheitsgesetz nicht anwendbar sei. Die Beklagte könnte sich somit durch eine Flucht ins Privatrecht den Geboten von Transparenz, Bürgernähe und Bürger- kontrolle entziehen. Dies widerspräche offensichtlich dem Willen des Gesetzgebers.
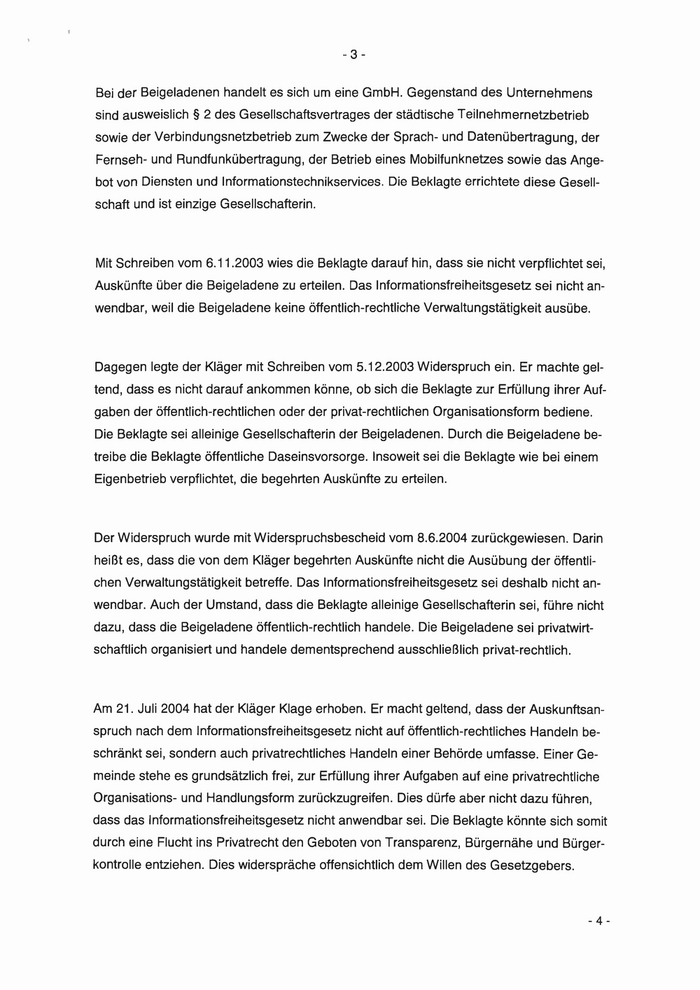
Es könne keinen Unterschied machen, ob die Beklagte einen öffentlich-rechtlich organi- sierten Eigenbetrieb oder eine privatrechtlich organisierte GmbH betreibe. Die Kontroll- und Transparenzinteressen der Bürger seien in beiden Fällen gleich zu bewerten. Das Informationsfreiheitsgesetz biete auch genügend Schutz für Geschäfts- und Betriebsge- heimnisse, sodass Wettbewerbsnachteile nicht zu befürchten seien. Im Übrigen sei die Telekommunikation Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Die Beklagte bediene sich deshalb einer gemeindeeigenen Gesellschaft zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre die kommunale Betei- ligung rechtswidrig. Nach $ 102 Abs. 2 iVm. $ 101 Abs. 1 Nr. 1 GO dürfe eine Gemeinde eine Gesellschaft nur gründen, wenn ein öffentlicher Zweck die Gesellschaft rechtfertige. Die Beklagte habe die Gründung der Beigeladenen auch damit gerechtfertigt, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Telekommunikation zum Bereich der öffentlichen Da- seinsvorsorge gehöre. An diese Zweckbestimmung sei die Beklagte gebunden. Der Kläger beantragt, die Beklagte unter Aufhebung der Bescheide vom 6.11.2003 und 8.6.2004 zu ver- pflichten, die mit Schreiben vom 8.9.2003 beantragten und mit Schriftsatz vom 05.09.2005 konkretisierten Auskünfte betreffend die Beigeladene vollumfänglich zu erteilen. Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Sie erwidert, dass sie sich der Beigeladenen nicht zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bediene. Das Betreiben einer Telekommunikationsgesellschaft erfolge privat- rechtlich und nicht öffentlich-rechtlich. Dies ergebe sich sowohl aus der Interessentheorie, der Subordinationstheorie als auch der Subjektstheorie. Insofern nehme die Beigeladene keine öffentlich-rechtlichen Aufgaben im Sinne des $ 3 Abs. 4 Informationsfreiheitsgesetz -5-
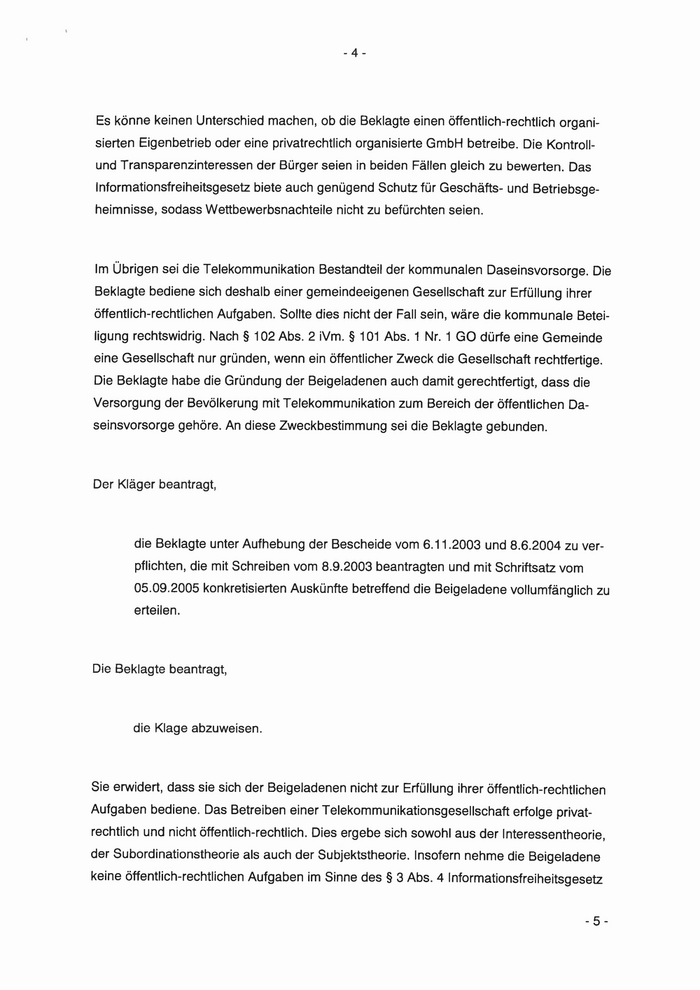
-5- wahr. Es sei auch aus verfassungsrechtlichen Gründen ausgeschlossen, den Betrieb ei- ner Telekommunikationsgesellschaft öffentlich-rechtlich zu betreiben. Insofern bediene sich die Beklagte auch keiner juristischen Person des privaten Rechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben. Die Beklagte habe auch gar keine rechtliche Verfügungsgewalt über die Informationen der Beigeladenen. Ein Ausgleich zwischen den Interessen der Kapitalgesellschaft und der Informationsberechtigten werde ausschließlich nach den Vorschriften des Handelsgesetz- buches hergestellt. Darüber hinaus seien keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften über den Zugang zu Informationen anwendbar. Der Aufsichtsrat würde auch der Verschwie- genheitspflicht unterliegen. Die Beigeladene beantragt, die Klage abzuweisen. Sie trägt vor, das sämtliche von dem Kläger begehrten Informationen den Inhalt von Ge- schäftsverbindungen beträfen. Diese seien aber als Geschäfts- und Betriebsgeheimnis geschützt. Zur Offenlegung von Informationen sei man ausschließlich nach dem Handels- gesetzbuch verpflichtet. Dort seien Vorschriften über die Art und Form der Publizität ab- schließend geregelt. Weitergehende Informationsansprüche bestünden nicht. In der mündlichen Verhandlung machte die Beigeladene darüber hinaus geltend , dass das Informationsfreiheitsgesetz auf juristische Personen des Privatrechts nur dann an- wendbar sei, wenn die juristische Person des Privatrechts öffentlich-rechtlich handelten. Insofern komme es nicht darauf an, ob die Beigeladene eine öffentliche Aufgabe wahr- nehme oder nicht. Entscheidend sei, ob sie öffentlich-rechtlich handele oder privat- rechtlich. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte und die beigezogenen Verwaltungsvorgänge Bezug genommen.
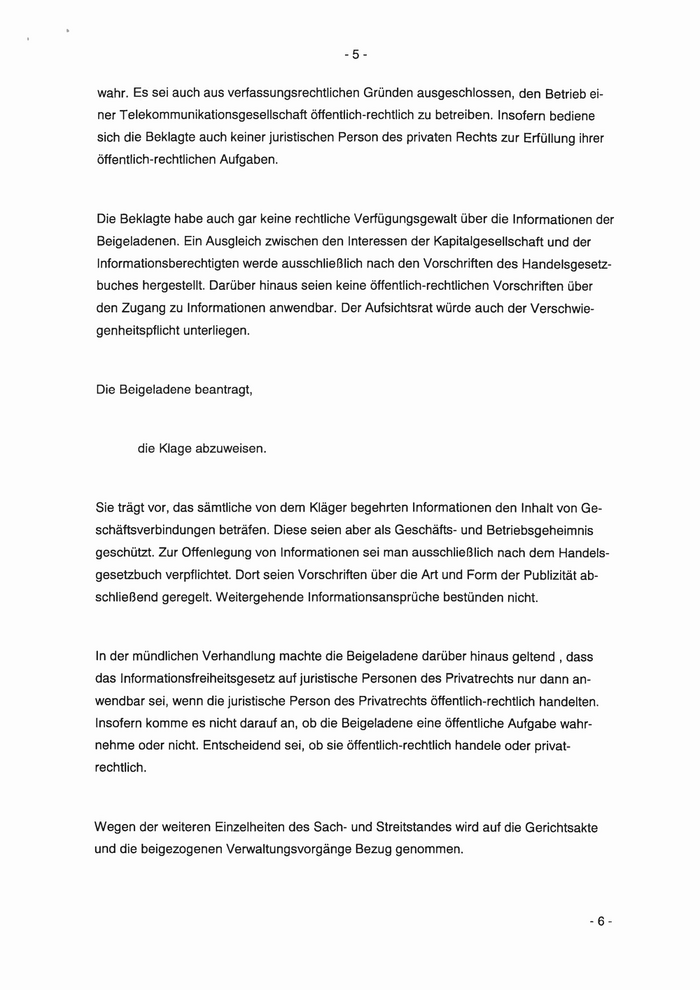
-6- Entscheidungsgründe Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Erteilung der von ihm begehrten Informationen durch die Beklagte. Die angefochtenen Bescheide sind rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten (vgl. $ 113 Abs. 5 VwGO). Die Klage ist zulässig. Zwar wurde die Klage gegen den vom 8. Juni 2004 datierten Wi- derspruchsbescheid erst am 21. Juli 2004 erhoben. Es fehlt aber an einer Zustellung des Widerspruchsbescheides gemäß $ 73 Abs. 3 VwGO, so dass die Monatsfrist des $ 74 Abs. 1 VwGO nicht in Gang gesetzt wurde. Die Klage richtet sich auch zu Recht gegen die Beklagte. Nach $ 6 Abs. 4 Informa- tionsfreiheitsgesetz (IFG) besteht für den Fall des $ 3 Abs. 4 IFG der Anspruch gegenüber derjenigen Behörde, die sich einer natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient. Die Beklagte und nicht die Bei- geladene selbst ist danach richtiger Adressat des Informationsbegehrens. Die Klage ist aber unbegründet. Als Anspruchsgrundlage kommt allein $ 4 IFG in Be- tracht. Danach hat jede natürliche und juristische Person des Privatrechts einen Anspruch auf Zugang zu den bei einer Behörde vorhandenen Informationen. Dabei steht einer Be- hörde eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder dieser Person die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen wird (8 3 Abs. 4 IFG). Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Weder bedient sich die Beklagte oder eine ihr zugeordnete Behörde der Beigeladenen zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Pflichten noch hat die Beklagte der Beigeladenen die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen. Allerdings ist der Begriff „öffentlich-rechtliche Aufgabe“ in $ 3 Abs. 4 IFG unklar und des- halb auslegungsbedürftig. Der Begriff lässt offen, ob die Vorschrift nur öffentliche Aufga- ben meint, die öffentlich-rechtlich wahrgenommen werden oder ob auch öffentliche Auf- gaben, die privatrechtlich wahrgenommen werden, umfasst sind.
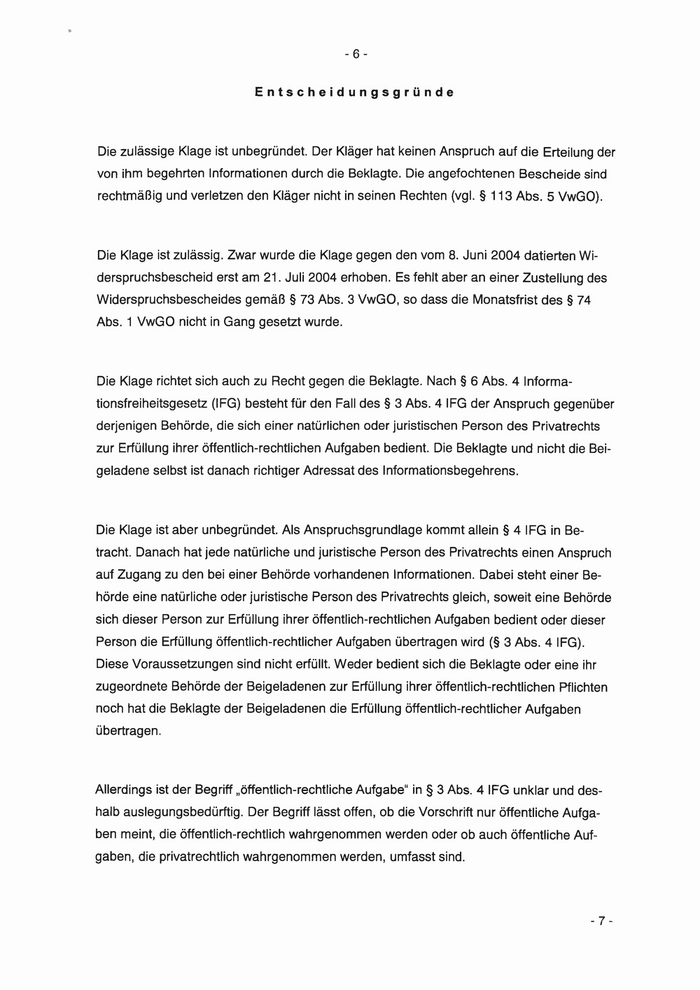
-7- Die erkennende Kammer ist der Auffassung, dass die Vorschrift dahingehend auszulegen ist, dass eine juristische Person des Privatrechts nur dann einer Behörde gleichsteht, wenn sie eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt und dabei öffentlich-rechtlich handelt. Der Wortlaut steht dem nicht entgegen. Zwar legt insbesondere das Wort „Aufgabe“ zunächst nahe, dass es um die Abgrenzung öffentlicher Aufgaben zu nicht-öffentlichen Aufgaben geht. Allerdings wäre dann die Formulierung „öffentlich-rechtlich“ nicht verständlich. In anderen Gesetzen wird von öffentlichen Aufgaben gesprochen, nicht aber von „öffentlich- rechtlichen Aufgaben“. Im Landesverwaltungsgesetz ist etwa von Aufgaben der öffentli- chen Verwaltung die Rede (vgl. 8$ 20, 22 Abs. 1, 23 und 24 Abs. 1 und 2 LVwG). Die Begriffe „öffentlich-rechtlich“ kommen im Landesverwaltungsgesetz dagegen nur dann vor, wenn es um die Ausübung der Verwaltungstätigkeit, also die Handlungsform geht, die entweder privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich erfolgt (vgl. $ 11, 8 12, 8 13 und $ 24 Abs. 1 und 2 LVwG). Insbesondere wird diese Unterscheidung zwischen Aufgabenebene und Handlungsform in $ 24 LVwG deutlich. Dort ist einerseits von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung die Re- de, die andererseits in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts (Abs. 1) bzw. in der Handlungsform des privaten Rechts (Abs. 2) zur Erledigung auf natürliche und juristische Personen des Privatrechts übertragen werden können. Die erkennende Kammer ist unter Berücksichtigung dieser Vorschriften des Landesver- waltungsgesetzes und der dortigen Systematik der Auffassung, dass die in $ 3 Abs. 4 IFG gewählte Formulierung an die Handlungsform anknüpft, dass es also um öffentliche Auf- gaben geht, die öffentlich-rechtlich wahrgenommen werden. Diese Auslegung entspricht auch offenkundig dem Willen des Gesetzgebers. Dies ergibt sich aus einer ersten Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Informa- tionsfreiheitsgesetzes im Schleswig-Holsteinischen Landtag am 24. September 2004 zu einem Gesetzentwurf des SSW (Schleswig-Holsteinischer Landtag, 15. Wahlperiode, Drucksache 15/3653). Dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass private Stellen informations- pflichtig nach dem IFG sind, soweit diese im Rahmen ihrer öffentlichen Zuständigkeiten, Aufgaben oder Dienstleistungen handeln ($ 3 Abs. 1 des Entwurfes; $ 3 Abs. 4 IFG soll diesem Entwurf zufolge gestrichen werden). Dieser Gesetzentwurf soll dem Problem der „Flucht ins Privatrecht“ begegnen. In der Debatte wird parteiübergreifend geäußert, dass -8-
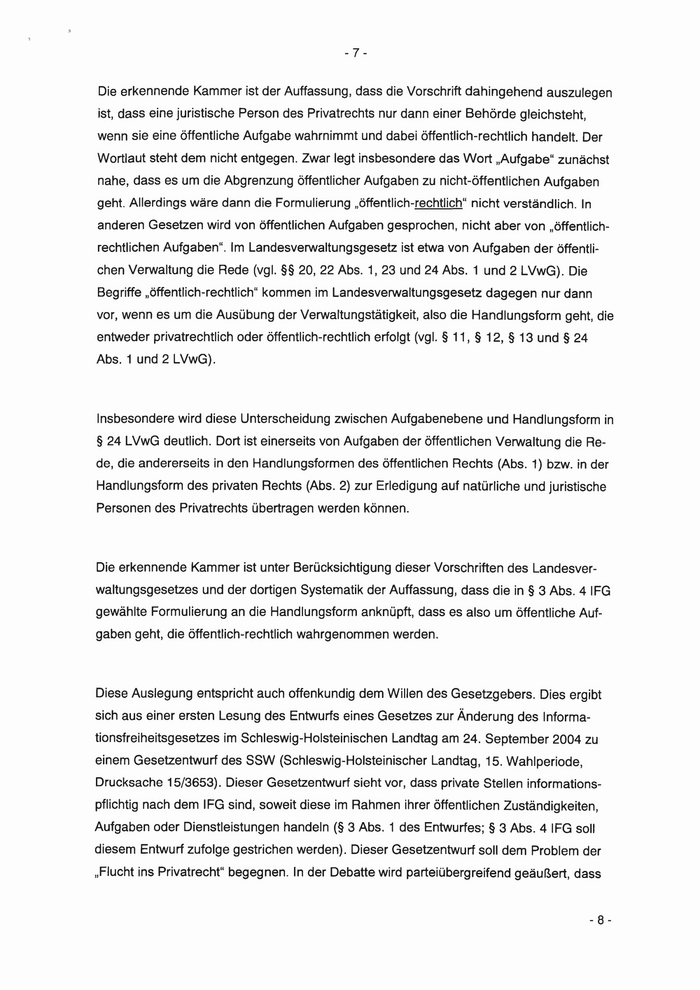
-8- nach der geltenden Gesetzeslage juristische Personen des Privatrechts nur dann nach $ 3 Abs. 4 IFG den Behörden gleichgestellt sind, wenn sie öffentlich-rechtlich handeln (vgl. Äußerungen des Abgeordneten Lars Harms, SSW, S. 9797; Abgeordneter Thomas Rother, SPD, S. 9799; Abgeordneter Johann Wadephul, CDU, S. 9800; Abgeordneter Heiner Gerk, FDP, S. 9802; Innenminister Klaus Buß, SPD; S. 9803). Weil diese geltende Rechtslage als unbefriedigend empfunden wird, soll dem Gesetzentwurf zufolge ein direk- ter Informationsanspruch gegenüber Privaten geschaffen werden, die öffentliche Aufga- ben wahrnehmen. Die Gesetzesänderung wäre aber nur unter Zugrundelegung der hier vertretenen Auffassung nötig. (Angemerkt sei, dass auch nach dem Gesetzentwurf jeden- falls dem Wortlauf nach weiterhin unklar bleibt, ob allein öffentliche Aufgaben, die öffent- lich-rechtlich ausgeführt werden oder auch solche, die privatrechtlich ausgeführt werden, gemeint sind). Auch die Kommentarliteratur geht davon aus, dass $ 3 Abs. 4 IFG dahingehend zu ver- stehen ist, dass mit dem Begriff „öffentlich-rechtliche Aufgabe“ öffentliche Aufgaben in der Handlungsform des öffentlichen Rechts gemeint sind (vgl. Friedersen, Kommentar zum Informationsfreiheitsgesetz $ 3 Ziff. 8). Die Begründung überzeugt allerdings nicht. Dort heißt es, dass durch die begriffliche Gleichstellung mit Behörden deutlich werde, dass das Informationsfreiheitsgesetz nur dann anzuwenden sei, wenn Personen des Privatrecht öffentliche Aufgaben in der Handlungsform des öffentlichen Rechts ausüben. Die erken- nende Kammer hat sich diese Argumentation nicht zu eigen gemacht. Mit Urteil vom 31. August 2004 (Az. 6 A 245/02, Die Gemeinde 2004, S. 256 ff.) ist vielmehr entschieden worden, dass Behörden auch dann informationspflichtig sind, wenn sie privatrechtlich handeln. Dies gilt aber nur für Behörden. Für natürliche und juristische Personen des Pri- vatrechts gilt die Einschränkung des $ 3 Abs. 4 IFG. Entgegen der Auffassung des Klägers ist auch im Hinblick auf die 8$ 101, 102 Gemein- deordnung (GO) kein anderes Ergebnis gerechtfertigt. Dort ist von „öffentlicher Zweck“ ($ 101 Abs. 1 Nr. 1 GO) bzw. „wichtiges Interesse“ (8 102 Abs. 1 Nr. 1 GO) die Rede. Auch unter Annahme eines öffentlichen Zwecks bzw. wichtigen Interesses an der Gründung der Beigeladenen durch die Beklagte (etwa im Bereich der Daseinsvorsorge) handelt die Bei- geladene nicht öffentlich-rechtlich, sondern ausschließlich privatrechtlich. Die Vorschrift des $ 3 Abs. 4 IFG ist aber nach dem oben Gesagten nur dann anwendbar, wenn eine juristische Person des Privatrechts auch öffentlich-rechtlich handelt.
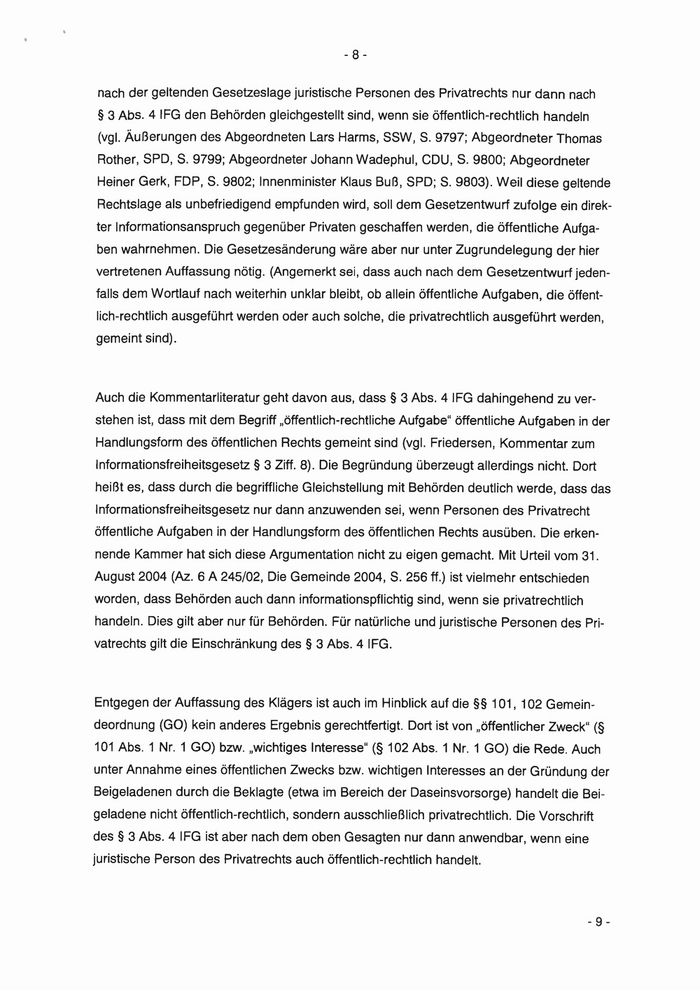
Die Kammer ist sich bewusst, das diese Auslegung den Anwendungsbereich von $ 3 Abs. 4 IFG stark einengt. Eine solche Beschränkung des Anwendungsbereiches könnte gegen den Sinn und Zweck des IFG verstoßen. Es könnte gesagt werden, dass der Gesetzgeber einen umfassenden verfahrensunabhängigen Informationszuganganspruch habe regeln wollen und eine erhöhte Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz von Verwal- tungsentscheidungen sowie der zugrunde liegenden politischen Beschlüsse habe ermög- lichen wollen (vgl. Urt. der erkennenden Kammer vom 31. August 2004, a.a.O., unter Be- zugnahme auf die Begründung zum Gesetzesentwurf, Landtagsdrucksache 14/2374, S. 11). Vor dem Hintergrund, dass $ 3 Abs. 4 IFG als Ausnahmevorschrift eng auszulegen ist und dem vom Gesetzgeber Gewollten und Gesagten ist aber für eine solche andere Ausle- gung kein Raum. Die Klage ist deshalb mit der Kostenfolge aus $ 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen sind gemäß $ 162 Abs. 3 VwGO erstat- tungsfähig, weil die Beigeladene einen eigenen und obsiegenden Antrag gestellt hat. Da- bei war allerdings klarzustellen, dass die Erstattungspflicht lediglich die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz umfasst. Soweit der Beigela- denen darüber hinaus Aufwendungen entstanden sind, sind diese nicht vom Kläger erstat- tungspflichtig. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf $ 167 Abs. 2 VwGO iVm den 88 708 Nr. 11, 711 ZPO. Die Berufung ist wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache zugelassen worden (vgl. $ 124 Abs. 1 iVm $ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO). -10-
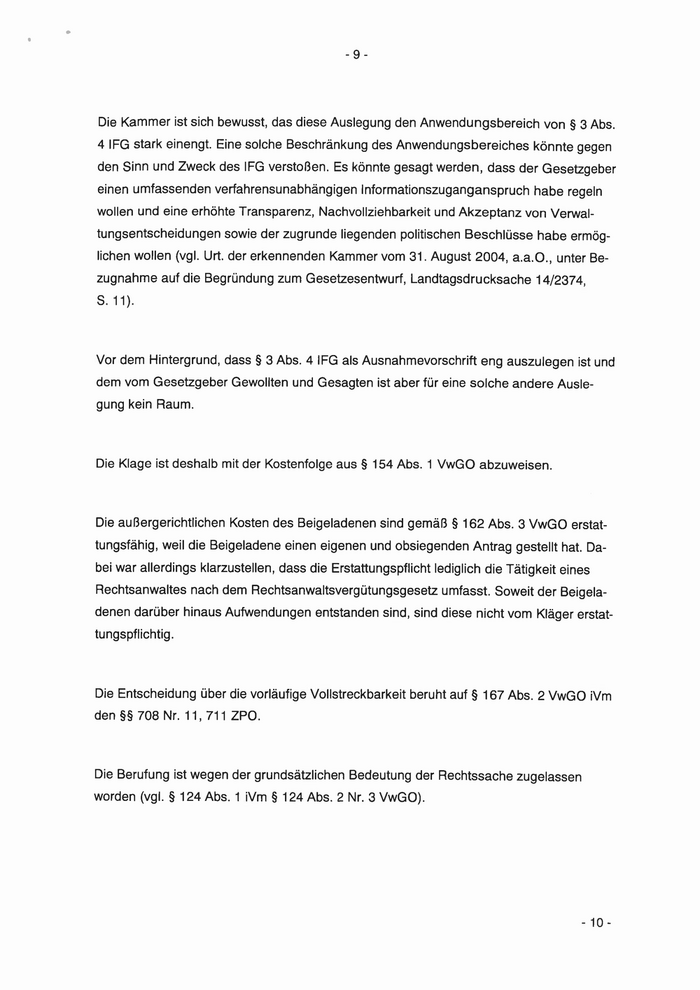
-10- Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung statthaft. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich oder zur Niederschrift des Ur- kundsbeamten der Geschäftsstelle beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht Brockdorff-Rantzau-Straße 13 24837 Schleswig einzulegen. Die Berufung muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begrün- den. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, bei dem Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht Brockdorff-Rantzau-Straße 13 24837 Schleswig einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung unzulässig. Jeder Beteiligte muss sich für diesen Antrag durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentli- chen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähi- gung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen.
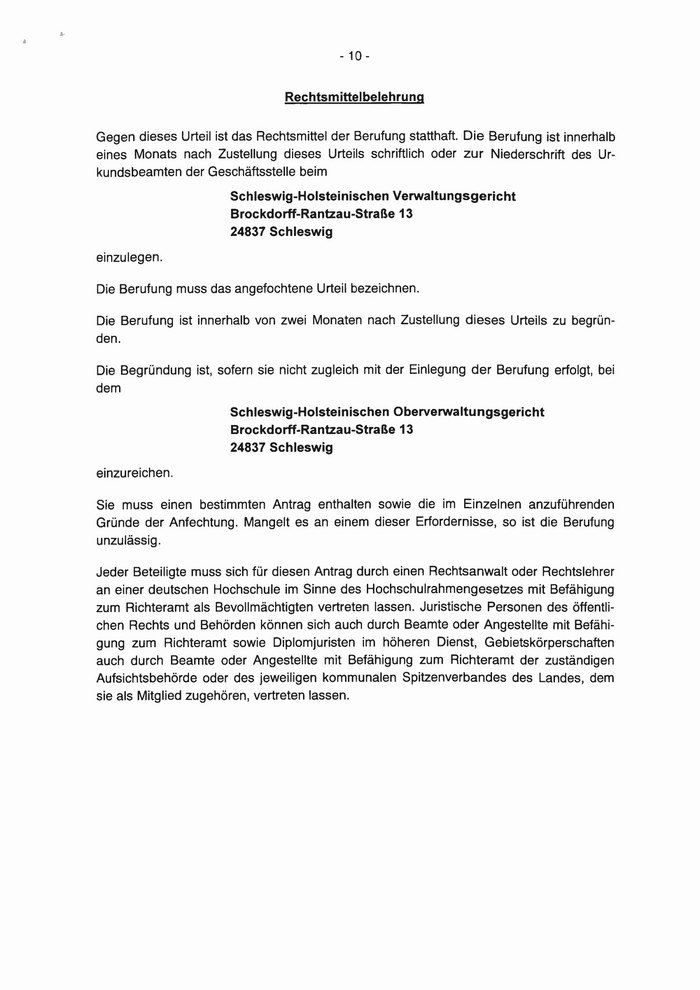
Das Projekt „Fragen und Antworten - Auskunftsrechte kennen und nutzen“ wird gefördert von:










