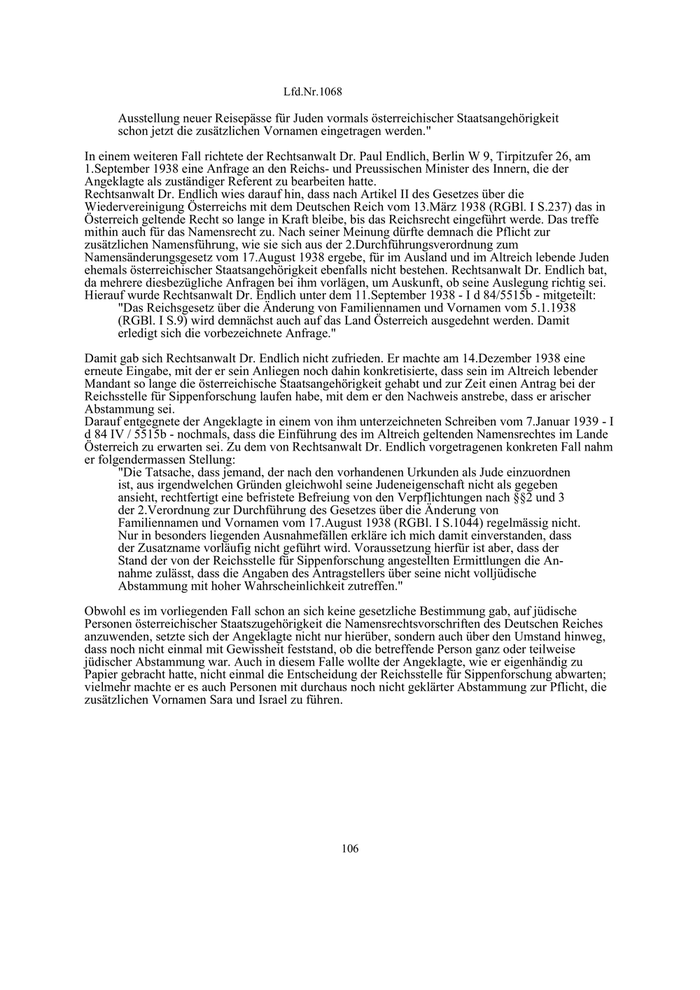Das Urteil gegen Globke
Lfd.Nr.1068 Namen bei nichtarischer Abstammung praktisch nicht mehr in Betracht komme. Der Angeklagte betonte, dass die Rückgängigmachung der in Betracht kommenden Namen nicht immer möglich sein würde, da die Akten teilweise nicht mehr greifbar wären. Im übrigen erfordere bislang die Namensänderung einen Antrag des Betroffenen. Es liesse sich jedoch im Wege des vereinfachten Gesetzgebungsverfahrens (Ermächtigungsgesetz) unschwer eine gesetzliche Änderung der bisherigen Vorschriften dahingehend bewirken, dass ein Antrag des Beteiligten nicht mehr Voraussetzung für eine Namensänderung sei. Er empfehle den Erlass eines solchen Gesetzes, um wenigstens in besonders krass liegenden Einzelfällen die Möglichkeit zu einer Rückgängigmachung der Namensänderung zu geben. Diesen hier erstmalig geäusserten Gedanken, bei dem er auch ausschliesslich Juden im Sinne hatte, verfolgte der Angeklagte in der Folgezeit beharrlich weiter. Mit dem Namensänderungsgesetz wurde er später dann auch verwirklicht. Bei der weiteren Beschäftigung mit dieser Materie stiess der Angeklagte noch auf andere Möglichkeiten der Namensänderung, die zu Ergebnissen führen konnten, die der faschistischen Rassepolitik, mit der sich der Angeklagte immer sichtbarer liierte, zuwiderliefen. Er machte am 28.Juli 1933 über seinen Minister eine Vorlage an den Reichsminister des Innern - 1 Z Allg. 16 II/33 -, die am 15.August 1933 abgefertigt wurde. Damit brachte er zunächst seine Anregung vom 6.Juni 1933 in Erinnerung, eine gesetzliche Möglichkeit zu schaffen, Namensänderungen, die seit der Staatsumwälzung 1918 vorgenommen worden seien, auch ohne Antrag des Namensträgers rückgängig zu machen. Ergänzend machte er darauf aufmerksam, dass Namensänderungen nicht nur durch einen Hoheitsakt der Verwaltungsbehörde, sondern auch durch Legitimation, Adoption, Einbenennung gemäss §1706 Abs.2 BGB und Wiederannahme des Mädchennamens durch die geschiedene Ehefrau gemäss §1577 BGB erfolgen können. Er schrieb dazu wörtlich: "Ich bin der Auffassung, dass auch insoweit dafür gesorgt werden muss, dass diese Möglichkeiten nicht dazu ausgenutzt werden, rassefremden Personen die Annahme eines die fremde Rasse verbergenden Namens zu erleichtern." Er wies im weiteren insbesondere auf die Adoptionsvorschrift des §1758 BGB hin, wonach das Kind den Familiennamen des Annehmenden erhalte. Hiervon, so legte der Angeklagte weiter dar, hätten in der Vergangenheit Nichtarier häufig Gebrauch gemacht, um ihren nichtarischen Namen, dessen Änderung im Verwaltungswege nicht erreicht worden sei, verschwinden zu lassen. Er habe dagegen zwar, soweit dies möglich gewesen sei, mit Berichtigungsverfahren nach §§65, 66 des Personenstandsgesetzes angekämpft. Da aber der Nachweis der Nichtigkeit oft nicht zu führen sein werde, halte er eine Änderung des §1758 BGB, und zwar mit rückwirkender Kraft, dahingehend für erforderlich, dass das anzunehmende Kind zusätzlich auch seinen früheren Familiennamen führen müsse. Da die Bearbeitung dieser Materie in erster Linie in die Zuständigkeit des Reichsjustizministers fiel, wurde auch ihm der Vorschlag zugeleitet. Den Bemühungen des Angeklagten sollte der Erfolg nicht versagt bleiben. Den Bericht des Angeklagten vom 6.Juni 1933 nahm der Reichsminister des Innern am 28.August 1933 - II B 5200/15.8. - zum Anlass eines Vorschlages an die preussischen Minister des Innern und für Justiz, mit der Rückgängigmachung von Abänderungen jüdischer in nichtjüdische Namen bis auf das Jahr 1914 oder womöglich sogar auf 1870 zurückzugehen. Er berief für den 20.September 1933 eine Besprechung ein, an der der Angeklagte als Vertreter des preussischen Innenministeriums teilnahm und das Ergebnis in einem Vermerk festhielt. Das Ergebnis dieser gesamten Bestrebungen, bei denen der Angeklagte mit seinen gegen den jüdischen Bevölkerungsteil Deutschlands gerichteten Vorschlägen grosse Eigeninitiative entwickelte, war zunächst das Gesetz gegen Missbräuche bei der Eheschliessung und der Annahme an Kindes Statt vom 23.November 1933 (RGBl. I S.979 und 1064). Die Gedanken, die der Angeklagte in seiner Vorlage vom 28.Juli 1933 zur Verhinderung von Namensänderungen jüdischer Personen durch Adoption usw. gemacht hatte, fanden deutlich erkennbar in diesem Gesetz ihre Verwirklichung. 97
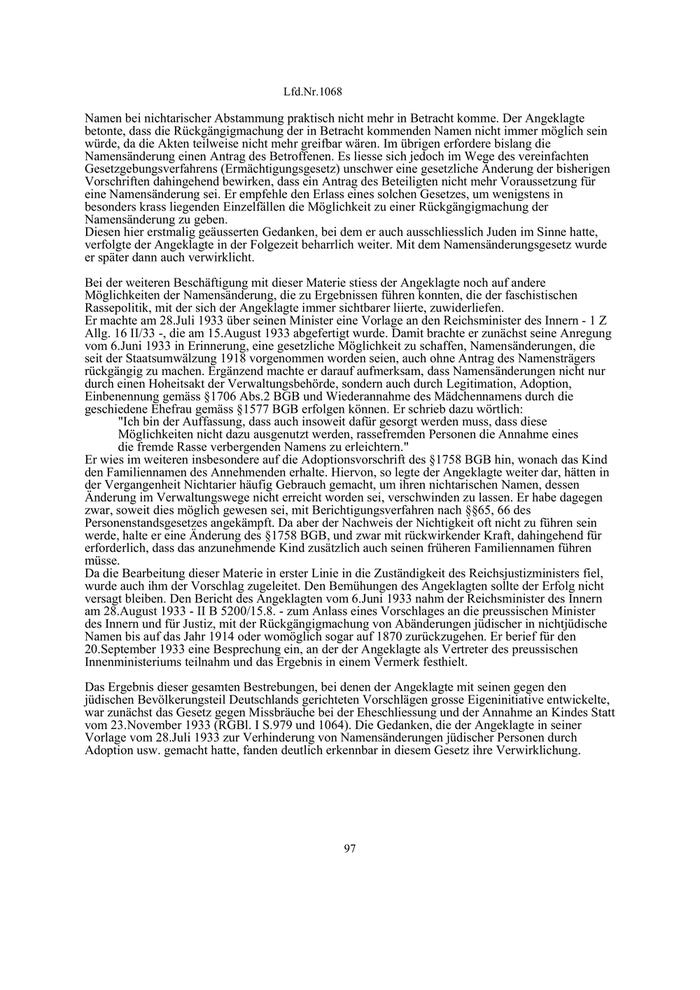
Lfd.Nr.1068 Das Gesetz ergänzte mit Artikel I Ziff.1 das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) durch einen §1325a, der bestimmte, dass eine Ehe nichtig sei, wenn sie ausschliesslich oder vorwiegend zu dem Zwecke geschlossen sei, der Frau die Führung des Familiennamens des Mannes zu ermöglichen. Mit Artikel I Ziff.4 (3) erhielt der §1754 BGB eine Neufassung dergestalt, dass die Bestätigung eines Adoptionsvertrages zu versagen sei, wenn im öffentlichen Interesse wichtige Gründe gegen die Herstellung eines Familienbandes zwischen den Vertragschliessenden sprächen. Um hierüber in jedem Einzelfall die Kontrolle zu haben, wurde mit Artikel I Ziff.4 Abs.3 den Gerichten auferlegt, vor der Entscheidung über den Bestätigungsantrag die höhere Verwaltungsbehörde zu hören. Eine weitere einschneidende Massnahme wurde mit Artikel V §1 getroffen, der die höhere Verwaltungsbehörde ermächtigte, seit November 1918 geschlossene Kindesannahmeverträge für nichtig erklären zu lassen, wenn anzunehmen sei, dass ein dem Eltern-Kind-Verhältnis entsprechendes Familienband nicht habe hergestellt werden sollen. Schon am 18.Dezember 1933 erliess das preussische Innenministerium einen vom Angeklagten ausgearbeiteten Erlass - I B 22/170 -, mit dem unverhohlen dargelegt wurde, was mit dem Gesetz vom 23.November 1933 beabsichtigt war. So wurde unter Abschnitt B einleitend gesagt, dass das Gesetz vom 23.November 1933 die Bekämpfung von Missbräuchen bezwecke, die sich in steigendem Masse seit der Staatsumwälzung am 9.November 1918 bei der Eheschliessung und der Annahme an Kindes Statt gezeigt hätten. Worin der Angeklagte diese Missbräuche erblickte, führte er so aus: "Insbesondere haben es Angehörige einer fremden Rasse verstanden, ihre Abstammung auf diese Weise zu verdecken." Unter Abschnitt II Ziff.1 wird dem Leser verdeutlicht, dass die höhere Verwaltungsbehörde die Gerichte zu beaufsichtigen und dass sie - das wird zwingend mit dem Runderlass angeordnet - der Bestätigung eines Adoptionsvertrages zu widersprechen habe, wenn "der Vertrag zwischen einem arischen und einem nichtarischen Vertragsteil geschlossen werden soll". Konsequent verfolgte der Angeklagte seinen eingeschlagenen Weg weiter, allen Bürgern, die ganz oder teilweise jüdischer Abstammung waren, ein Entgehen vor den nazistischen Verfolgungen durch Namensänderungen zu vereiteln. In zahlreichen Aktenvorgängen, die dem Obersten Gericht vorgelegen haben, zeigt sich die unerbittliche Haltung des Angeklagten, der in Durchführung des von ihm verfassten Erlasses vom 18.Dezember 1933 rücksichtslos alle Anträge auf Namensänderungen nicht "vollarischer" Personen ablehnte. Bemerkenswert ist hierbei, dass der Angeklagte, der immer wieder in der Öffentlichkeit behauptet, für die Nichtgleichstellung der sogenannten Halbjuden mit Volljuden während der Zeit der Hitlerdiktatur hartnäckig und auch erfolgreich gekämpft zu haben, ausnahmslos auch die Anträge jüdischer Mischlinge ablehnte. So schilderte am 25.Oktober 1933 die aus einer sog. Mischehe stammende 17 Jahre alte Liselotte Moser, die in einer Erwerbslosensiedlung von Wohlfahrtsunterstützung lebte, in einer vom Angeklagten bearbeiteten Eingabe, wie sie immer wieder durch ihre an ihrem Namen erkennbare Abkunft daran gehindert wurde, selbst die untergeordnetste Tätigkeit in einem Haushalt zu erlangen. Verzweifelt stellte das Mädchen die Frage, ob dies ihr ganzes Leben so weitergehen solle. Kalt teilte ihr der Angeklagte am 30.Oktober 1933 - I Z. M. 104 - in wenigen Zeilen die Ablehnung ihres Antrages "aus grundsätzlichen Erwägungen" mit. Die ebenfalls aus einer Mischehe stammende 23 Jahre alte Margarete Cohn wollte den Geburtsnamen ihrer Mutter - Marinski - annehmen, da ihr Verlobter der Schutzpolizei angehörte und sie Schwierigkeiten für die beabsichtigte Eheschliessung befürchtete. Der Angeklagte ermächtigte am 16.Dezember 1933 - I Z. C. 38 - den Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) in seiner Eigenschaft als Ortspolizeibehörde, die Antragstellerin ablehnend zu bescheiden. Bezeichnend ist auch der Fall des Reisenden Johann Cahn, der sich darüber beklagte, dass er durch den jüdisch klingenden Namen in seinem Beruf ständig Nachteile habe und er sich 98
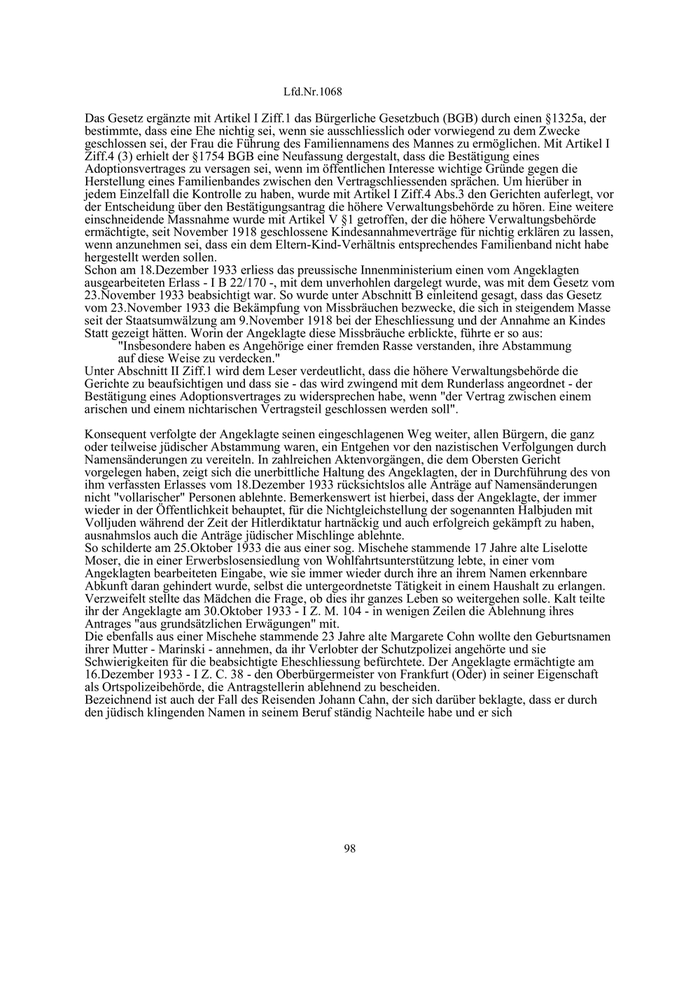
Lfd.Nr.1068 bedeutend freier fühlen würde, wenn er unter gleichdenkenden Menschen einen deutschklingenden Namen führen könnte. Er bat um Änderung seines Namens in Koch. Das Gesuch wurde seitens des Regierungspräsidenten in Düsseldorf befürwortet. Der Angeklagte lehnte am 7.September 1933 - I Z. C. 35 - den Antrag dennoch, und zwar mit folgender Begründung ab: "Dem Gesuche des Johann Paul Cahn in Solingen um Erteilung der Genehmigung zur Führung des Familiennamens Koch ist nach Prüfung der Sachlage nicht entsprochen worden, weil seine arische Abstammung nicht ausreichend nachgewiesen ist. Im Gegensatz zu Cohn (Kohn) ist der Name Cahn (Kahn) ein typisch jüdischer Name, dessen Führung durch Personen arischer Abstammung kaum jemals vorkommen wird. An den Nachweis dieser Abstammung müssen daher besonders strenge Anforderungen gestellt werden." Anschaulich haben die als Zeugen gehörten Eheleute Emmy und Bernhard Ko. ihren Leidensweg in der Zeit der faschistischen Herrschaft geschildert. Der Arbeiter Bernhard Ko. ersuchte angesichts der sich nach der Machtergreifung durch die Faschisten zusehends verstärkenden antisemitischen Ausschreitungen um Änderung seines Namens in Köhn. Er begründete sein Gesuch damit, dass er im Jahre 1923 der evangelischen Kirche beigetreten und Soldat im ersten Weltkrieg gewesen sei. Am 8.Juli 1933 lehnte der Angeklagte das Gesuch ab. In der Folgezeit war das Ehepaar Ko. allen nur denkbaren Schikanen und Verfolgungen ausgesetzt, die auch Frau Ko. zu erdulden hatte, weil sie die immer wieder an sie gestellten Ansinnen, sich von ihrem Ehemann scheiden zu lassen, zurückwies. Herr Ko. wurde 1936 entlassen, weil der Betrieb "rein arisch" sein wollte. Er bekam eine mit dem "J" versehene Kennkarte, musste später zusätzlich den Namen "Israel" annehmen und den sogenannten Judenstern tragen. Auch aus der Wohnung wurden sie ausgewiesen. Frau Ko. durfte nicht in "arischen" Geschäften einkaufen und war auch sonst überall Anfeindungen wegen ihrer ehelichen Bindung ausgesetzt. Im Februar 1945 nahmen die Faschisten auch keine Rücksicht mehr darauf, dass Herr Ko. mit einer Nichtjüdin verheiratet war. Sie verbrachten ihn nach Theresienstadt, und es gab bis zu seiner Befreiung keinerlei Verbindung mehr zwischen den Eheleuten. In gleicher Weise wie bei Namensänderungsanträgen verfuhren der Angeklagte und andere Mitarbeiter der Abteilung I bei beabsichtigten Annahmen an Kindes Statt. Auch hierzu gibt es umfangreiches Beweismaterial. So wollte beispielsweise den aus einer geschiedenen Mischehe stammenden Wolf Löwenstein sein Stiefvater adoptieren. Der Württembergische Innenminister hielt dies in öffentlichem Interesse für unerwünscht, weil durch die Annahme an Kindes Statt die halbjüdische Abstammung des Jungen verschleiert würde. Diesen Standpunkt teilte der Angeklagte mit Schreiben vom 1.Februar 1939 - I d. L. 58/5654 -, und er gab die Ermächtigung, dem Antrage zu widersprechen. Am 28.Juni 1942 bat Frau Bertha Böckstiegel aus Berlin-Dahlem inständig darum, ein 15 Jahre altes Mädchen adoptieren zu dürfen, an dem sie schon seit dem Jahre 1937 die Mutterstelle vertrat. Aus jedem ihrer Worte wurde das innige Verhältnis sichtbar, das zwischen den beiden Menschen bestand. Da das Kind nach den faschistischen Abstammungsregeln jüdischer Mischling ersten Grades war, wurde das Gesuch abgelehnt. Ebenso wurde das Gesuch der Eheleute Bleitner vom 9.Mai 1941 abgelehnt, den jüdischen Mischling ersten Grades Karl-Heinz Kusch adoptieren zu dürfen. Es wurde eingeräumt, dass die Eheleute Bleitner in geordneten Verhältnissen lebten, mit grosser Liebe an dem Pflegekind hingen und auch in den Jahren eigener wirtschaftlicher Notlage selbstlos für den Jungen eingetreten waren. Aber ausser der Tatsache, dass das Pflegekind Mischling sei, müsse die Ablehnung auch erfolgen, weil der Ehemann Bleitner politisch nicht zuverlässig sei. Er sei früher gewerkschaftlicher Referent der SPD gewesen, und seine politische Haltung lasse nach Einschätzung der Gauleitung der NSDAP Halle-Merseburg erkennen, "dass er auch bis heute für den Nationalsozialismus kein Verständnis aufbringen kann". 99
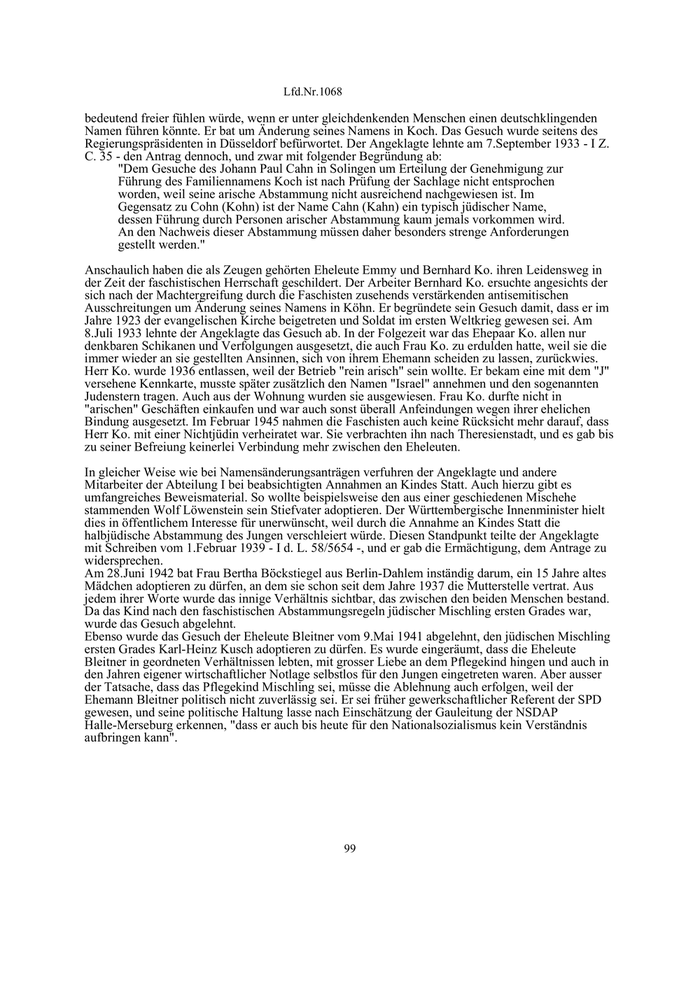
Lfd.Nr.1068 Wie sehr diese Entscheidungen der eigenen Einstellung des Angeklagten entsprachen, ergibt sich aus einem von ihm verfassten Schreiben, das am 15.März 1934 - 1 Z. 10/1934 - an den Reichsminister des Innern mit der Anfrage ging, ob im Interesse der erhöhten Bedeutung der Rassenpflege an der bisherigen Praxis festgehalten werden solle. Durch das preussische Innenministerium seien bisher zwar nur Namen von Personen arischer Abstammung geändert worden, um eine Verschleierung der Rassenzugehörigkeit zu verhindern. Neuerdings gäbe es aber auch Anträge auf Verdeutschung von Namen, deren Träger z.B. ungarische Vorfahren hätten. Die Ungarn und Finnen seien aber keine Arier, und es frage sich, wie in diesen Fällen zu verfahren sei. Am 25.Juni 1934 fand die Neubearbeitung der Namensänderungen durch den Angeklagten Billigung. Die für ihn dabei massgeblichen Grundgedanken hatte er in einem Vermerk - I Z. 10 IV - festgehalten. Insbesondere hielt er die Aufnahme von Vorschriften über den Nachweis der arischen Abstammung für dringlich. Weiter hielt er nun den Zeitpunkt für gekommen, die im Jahre 1932 aus gutem Grunde unveröffentlicht gelassenen Richtlinien für die inhaltliche Bearbeitung der Anträge auf Namensänderung nunmehr zu veröffentlichen, "da eine Kenntnis dieser Richtlinien in zahlreichen Fällen die Stellung aussichtsloser Anträge verhindern wird". Um in dieser Beziehung keine Zweifel aufkommen zu lassen, bearbeitete er den Abschnitt "Judennamen" völlig neu. Der entscheidende Passus lautete nunmehr: "Anträgen von Personen nichtarischer Abstammung, ihren Namen zu ändern, wird grundsätzlich nicht stattgegeben, weil durch die Änderung des Namens die nichtarische Abstammung des Namensträgers verschleiert würde. Auch der Übertritt zum Christentum ist nicht geeignet, eine Namensänderung zu begründen." Die vom Angeklagten ausgearbeiteten Neuregelungen zur Namensänderung ergingen als Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit zur Änderung von Familien- und Vornamen mit einem Runderlass und den überarbeiteten Richtlinien aus dem Jahre 1932 (Pr.GS 1934 S.316, MBliV. 1934 S.886 ff.). Einer der führenden Leute der chauvinistischen "Alldeutschen Bewegung", von und zu Loewenstein, sandte am 25.Mai 1935 an das Reichs- und Preussische Ministerium des Innern zu Händen des Regierungsrates Dr. Gisevius "das gewünschte Material". Es handelte sich um den Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Schutz von Familiennamen. Der §1 hatte folgenden Wortlaut: "Familiennamen von politischer, geschichtlicher oder kultureller Bedeutung stehen fortan unter gesetzlichem Schutz. Sie dürfen nicht beliebig angenommen werden. Nichtarische Familien, welche seit dem Jahre 1806 solche geschützten Familiennamen angenommen haben, sind zur Änderung ihres Familiennamens verpflichtet, widrigenfalls der Familienname von Amts wegen geändert wird." Nachdem der damalige Reichsinnenminister Frick den von Loewenstein eingereichten Entwurf zur Kenntnis genommen hatte, vermerkte er dazu, dass der Grundgedanke gesund sei und verdiene, Gesetz zu werden. Er verfügte die gesetzgeberische Bearbeitung und Bericht hierüber bis zum 1.Oktober 1935. Der Angeklagte legte bereits am 14.August 1935 den Referentenentwurf für ein Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vor. Der Entwurf wurde am 14.August 1935 dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsminister der Justiz zur Stellungnahme zugeleitet. In dem Anschreiben - I B (I Z. Allg. 26) - hob der Angeklagte als besonderen Vorzug des beabsichtigten Gesetzes hervor, dass die vor dem 30.Januar 1933 genehmigten Namensänderungen widerrufen werden könnten, wenn sie "nicht als erwünscht" anzusehen seien. Damit sei vor allem die Möglichkeit gegeben, Namensänderungen, die der Verschleierung der jüdischen Abstammung dienten, rückgängig zu machen. Damit hatte der Angeklagte das mit dem Gesetz angestrebte Ziel unmissverständlich genannt. 100
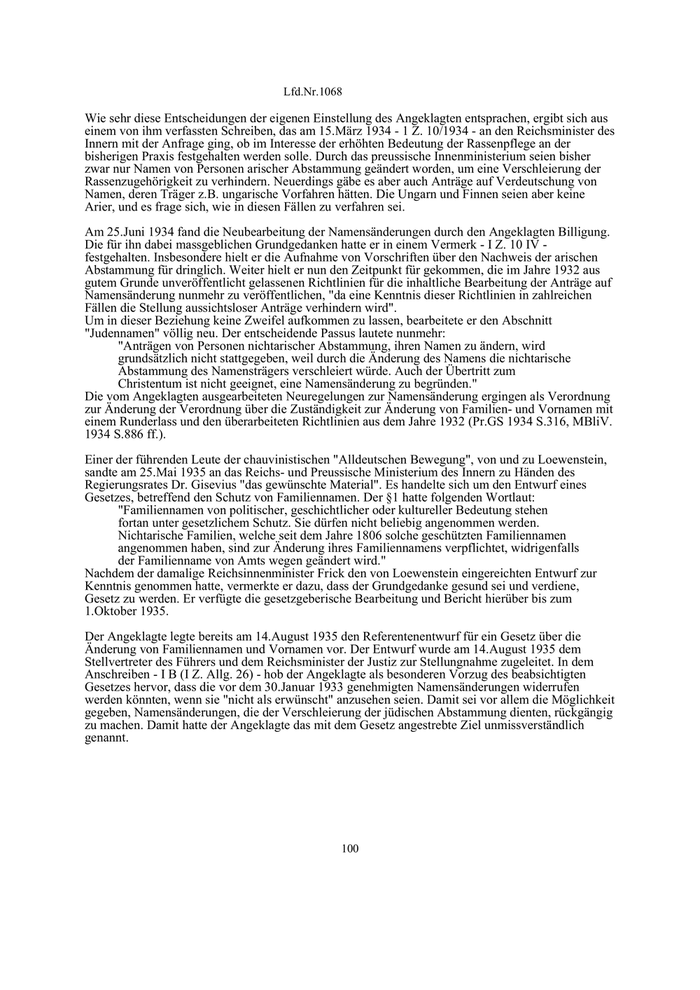
Lfd.Nr.1068 Dem Angeklagten gefiel offenkundig aber auch der Vorschlag des von und zu Loewenstein. Mit diesem übereinstimmend hielt auch er den Zustand für unbefriedigend, dass sich deutsche Sippen zur Aufgabe ihrer ererbten Namen gezwungen sähen, weil Juden ebenfalls diese Namen angenommen hätten und die betreffenden Namen heutzutage als typisch jüdisch angesehen würden. Er hielt auch schon die juristische Regelung bereit, die diesen nach seiner Meinung unbefriedigenden Zustand beseitigen könnte. Deshalb schlug er vor, in den vorgelegten Referentenentwurf noch einen §7a folgenden Wortlauts einzufügen: "Hat ein Jude einen Familiennamen angenommen, der auch von deutschen Sippen getragen wird, so kann der Reichsminister des Innern seinen Nachkommen die Führung dieses Namens untersagen und ihnen die Führung eines jüdischen Namens aufgeben." Wie §14 des Referentenentwurfes ausweist, ging der Vorschlag des Angeklagten dahin, das Namensänderungsgesetz bereits am 1.Januar 1936 zu erlassen. Der Angeklagte hat am 28.April 1961 im westdeutschen Fernsehen sinngemäss zum Ausdruck gebracht, dass es seiner Standhaftigkeit als Bearbeiter des Gesetzes zu danken sei, dass es nicht einen weit schärferen Inhalt bekommen habe. Die vorliegenden Tatsachen beweisen die Unwahrheit dieser seiner Behauptung. Richtig ist vielmehr, dass der Angeklagte selbst mit seinem Vorschlag auf Einführung des §7a eine weitaus diskriminierendere Form des Gesetzes vorbereitet hatte, und es waren auch durchaus keine lauteren Motive, die ihn diesen Gedanken nicht weiterverfolgen liessen. Denn durch die am 15.September 1935 ergangenen Nürnberger Rassengesetze konnten diese Fragen anders gelöst werden. Diesen einzigen für den Angeklagten massgeblichen Grund brachte er auch in einem Bericht an Minister Frick am 18.April 1936 zum Ausdruck, mit dem er darlegte, dass die ohnedies nur schwierig durchzuführende Entziehung aller deutschen Namen nicht mehr so dringlich erscheine, da die durch die Nürnberger Gesetzgebung eingeleitete scharfe Trennung zwischen Juden und Deutschen auf anderen Gebieten als auf dem Gebiete des Namensrechts systematisch zu Ende geführt werde. Eine gewisse Zurückhaltung im gegenwärtigen Zeitpunkt hielt der Angeklagte auch im Hinblick auf die Olympiade für ratsam. Am 15.Juni 1936 - V 32/36 Ads. - teilte Himmler dem Staatssekretär Pfundtner vom R.u.Pr.MdI mit, dass der "Führer" eine gesetzliche Regelung wünsche, womit Juden verboten werden solle, die Namen Siegfried und Thusnelda zu führen. Obgleich die genannte Anregung eine deutliche Abgrenzung zeigt, behandelte der Angeklagte die Sache unter dem Gesichtspunkt des Verbotes der Führung sämtlicher deutscher Vornamen durch Juden. Sein einziges Bedenken war, dass die Entziehung der bisher von Juden geführten deutschen Vornamen es "übel beleumdeten Juden" ermöglichen könnte, ihre Identität zu verschleiern. Sein Vorschlag ging dahin, dass zur Verwirklichung der Anregung Hitlers ein Gesetz erforderlich sei, das aber erst nach der Olympiade in Angriff genommen werden könne. In ein anzufertigendes Verzeichnis jüdischer Vornamen sollten diese nur in der hebräischen und nicht in der eingedeutschten Form aufgenommen werden. In diesem Sinne wurde Himmler am 15.Juli 1936 - I B Z Allg. 17 - benachrichtigt. Auf ein Schreiben eines Freiherrn von Münchhausen vom 25.September 1936, der die Forderung nach Ablegung deutscher Namen von Juden erhob, wurde der Angeklagte zum Vortrag befohlen. Sein Vorschlag, den inzwischen überarbeiteten Entwurf eines Namensänderungsgesetzes erneut dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsjustizminister vorzulegen, fand Billigung. In dem vom Angeklagten verfassten Anschreiben vom 10.Februar 1937 - I B I Z Allg. 17 II/36 - wies er darauf hin, dass entsprechend einer Anregung des Reichsführers SS ein neuer §12 eingefügt worden sei, der den Reichsminister des Innern ermächtige, Vorschriften über die Führung von Vornamen zu erlassen und Vornamen, die diesen Vorschriften nicht entsprächen, von Amts wegen zu ändern. Unverblümt schrieb er weiter, dass dabei in erster Linie an eine Vorschrift gedacht sei, die den Juden nur die Annahme jüdischer Vornamen 101
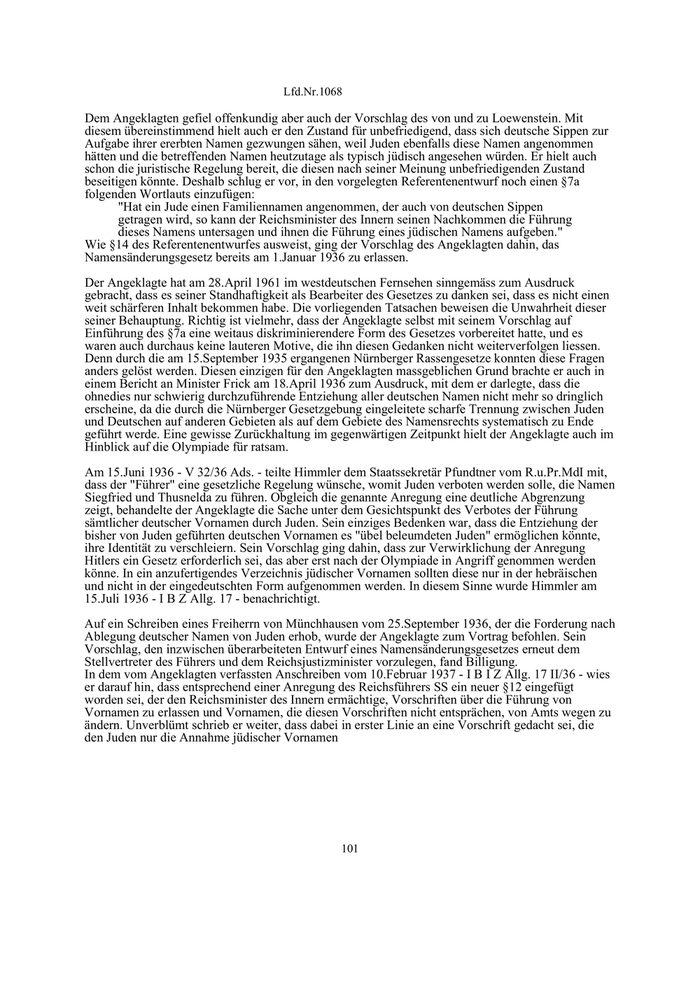
Lfd.Nr.1068 gestatte. Erstmalig äusserte der Angeklagte in diesem Zusammenhang offen die Absicht, eine gesetzliche Verpflichtung zur Führung zusätzlicher jüdischer Vornamen zu schaffen. Wörtlich heisst es hierzu: "... soweit sie andere Vornamen führen, für die es eine hebräische Form nicht gibt, wird daran gedacht werden können, sie zur Führung eines bestimmten zusätzlichen jüdischen Vornamens zu verpflichten. Für die vollständige oder teilweise Durchführung dieser Massnahmen wird jeweils ein geeigneter Zeitpunkt abgewartet werden können." Seine Verwirklichung hat dieser Vorschlag des Angeklagten "zum gegebenen Zeitpunkt", nämlich am 17.August 1938, mit der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Namensänderungsgesetzes gefunden, die jüdischen Bürgern aufgab, sich zusätzlich Sara bzw. Israel zu nennen. In dem nachfolgenden Schriftwechsel über den Entwurf des Namensänderungsgesetzes versuchte der Stellvertreter des Führers, an Stelle der in den §§7, 8 und 12 vorgesehenen Zuständigkeit des R.u.Pr.MdI die Zuständigkeit der höheren Verwaltungsbehörde zu begründen. In seiner Erwiderung vom 27.April 1937 liess der Angeklagte seine wahren Absichten erkennen. Er führte aus: "Die Durchführung des §12 soll, wie aus meinem Schreiben vom 10.2.1937 - I B I Z. Allg. 17 II/36 - ersichtlich ist, in erster Linie dazu dienen, die Juden zur Annahme jüdischer Vornamen zu veranlassen. Dabei ist nicht daran gedacht, dieses Ziel durch Einzelanordnungen zu erreichen. Es ist vielmehr in Aussicht genommen, gegebenenfalls eine allgemeine Anordnung zu treffen, die sich unmittelbar auf den Vornamen des einzelnen Juden auswirkt. Eine solche allgemeine Anordnung kann aber nur von zentraler Stelle getroffen werden." Damit räumte der Angeklagte den Widerstand des Stellvertreters des Führers aus. Das Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen wurde am 5.Januar 1938 im Umlaufwege beschlossen (RGBl. I S.9). Nach §7 Abs.1 konnten nunmehr Namensänderungen, die vor dem 30.Januar 1933 genehmigt worden waren, bis zum 31.Dezember 1940 widerrufen werden, wenn diese Namensänderungen als "nicht erwünscht anzusehen" waren. §7 Abs.2 bestimmte, dass durch den Widerruf auch die Personen den Namen verloren, die ihr Recht zur Namensführung von der Person ableiteten, die der Widerruf betraf. In der Begründung des Gesetzes schrieb der Angeklagte zu §7: "§7 gibt die bisher nicht vorhandene Möglichkeit, unerwünschte Namensänderungen, die vor der Machtergreifung genehmigt worden sind, zu widerrufen. Dadurch ist insbesondere die Handhabe gegeben, die zu Tarnungszwecken erfolgte Annahme deutscher Namen durch Juden rückgängig zu machen." Zu §11, mit dem die Vorschriften über Namensänderung auch auf Vornamen für entsprechend anwendbar erklärt wurden, gab der Angeklagte folgende Begründung: "Eine Neuerung gegenüber diesem ist die Möglichkeit, wie die Änderung von Familiennamen, so auch die Änderung von Vornamen zu widerrufen. Diese Vorschrift wird insbesondere auf die Fälle Anwendung finden, in denen ein jüdischer Vorname durch einen deutschen ersetzt worden ist." 3 Diese Bestimmung des §12 besagte, dass der Reichsminister des Innern Vorschriften über die Führung von Vornamen erlassen und von Amts wegen die Änderung von Vornamen, die diesen Vorschriften nicht entsprachen, veranlassen konnte. Seine hiermit verfolgten Absichten, die der Angeklagte bereits in dem Schriftwechsel mit dem Stellvertreter des Führers kundgetan hatte, kehren in der Begründung zu §12 wieder: 3 Richtig wohl: Die. 102
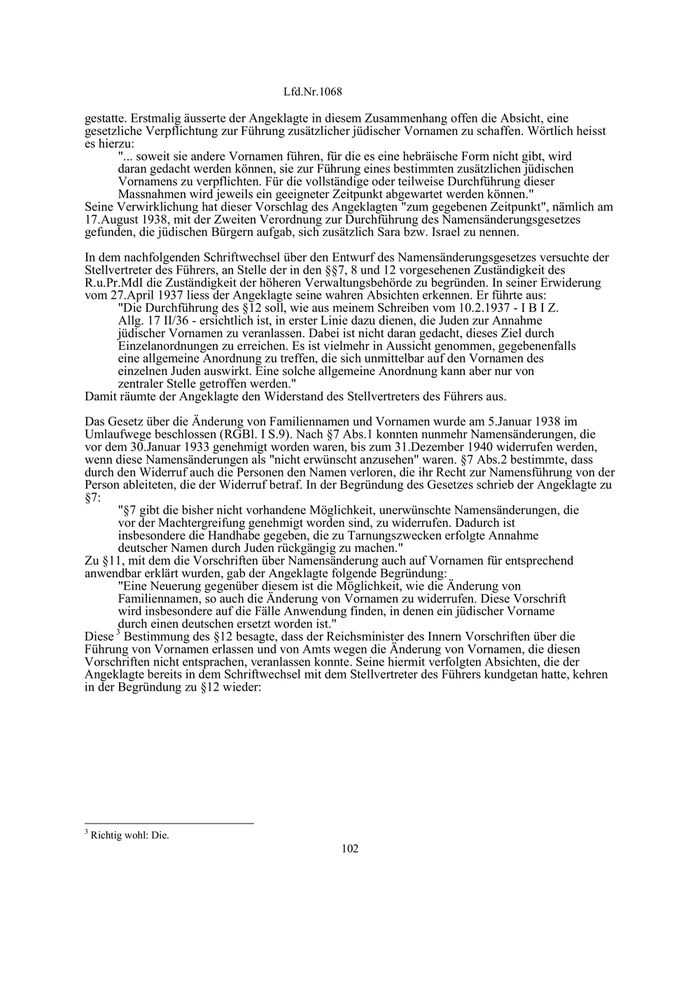
Lfd.Nr.1068 "Dadurch ist vor allem die Möglichkeit geschaffen worden, die Juden auf die Wahl von jüdischen Vornamen zu beschränken. Soweit Juden z.Z. nichtjüdische Vornamen tragen, kann der Reichsminister des Innern die Änderung dieser Vornamen von Amts wegen veranlassen. Inwieweit und wann von dieser Befugnis Gebrauch gemacht wird, hängt im wesentlichen von politischen Erwägungen ab. Es ist dabei nicht zu verkennen, dass dieser Änderung auch verwaltungsmässige Schwierigkeiten entgegenstehen, insofern als die Änderungen zu Schwierigkeiten bei der Identitätsfeststellung führen können und eine Berichtigung aller amtlichen Listen, Register usw. erforderlich machen. Diese Schwierigkeiten können aber dadurch im wesentlichen ausgeräumt werden, dass an Stelle eines Austausches der vorhandenen Vornamen die zusätzliche Führung eines typisch jüdischen Vornamens (z.B. Israel) angeordnet wird, der bei jeder Unterschrift usw. mitverwendet werden muss." Zur eingehenden Anweisung der Verwaltungsbehörden hatte der Angeklagte auch einen Runderlass nebst Richtlinien ausgearbeitet, der unmittelbar nach dem Gesetz am 8.Januar 1938 erging. Damit spitzte der Angeklagte den judenfeindlichen Inhalt der bisherigen Verwaltungsanweisungen zu diesen Fragen weiter zu. Der Abschnitt "Judennamen" wurde unter VII Abs.2 in den Richtlinien (MBliV. 1938 S.69 ff.) nunmehr so gefasst: "Anträgen von Juden und Mischlingen, ihren Namen zu ändern, wird grundsätzlich nicht stattgegeben, weil durch die Änderung des Namens die Abstammung des Namensträgers verschleiert würde. Dagegen kann solchen Anträgen entsprochen werden, wenn der Antragsteller zwar einen geringfügigen jüdischen Bluteinschlag aufweist, aber nicht Mischling ist." Unter Ziff.10 Abs.1 des Runderlasses wurde für die in den Richtlinien in dem Abschnitt "Judennamen" genannten Fälle den Verwaltungsbehörden aufgegeben, die zuständige Staatspolizeistelle zu hören. Diese Abmachung hatte der Angeklagte, wie sein handschriftlicher Vermerk auf dem Schnellbrief vom 20.Dezember 1937 - V 1 Nr.154 VIII/37 - 176 - beweist, mit der Sicherheitspolizei getroffen. Während sich die judenfeindlichen Massnahmen staatlicherseits in der Zeit von 1933 bis 1935 vorrangig darauf konzentrierten, die jüdischen Bürger aus allen Gebieten des öffentlichen Lebens auszuschalten, wurde mit dem Erlass der Nürnberger Gesetze im Jahre 1935 bis zum Jahre 1938 den Juden nach und nach die Betätigung in nahezu allen Berufsgruppen untersagt, ihre Entlassung aus dem öffentlichen Dienst gesetzlich angeordnet und mit Drohungen und Erpressungen, einsetzend mit dem Jahre 1937, auch die Zwangsarisierung der Wirtschaft betrieben. Der Antisemitismus nahm immer krassere Formen an. In dieser Situation der immer brutaler werdenden Terroraktionen gegen den jüdischen Bevölkerungsteil Deutschlands reifte der geeignete politische Zeitpunkt heran, von dem der Angeklagte in der Begründung zu §12 des Namensänderungsgesetzes gesprochen hatte, der es entsprechend dem erreichten Stand der nazistischen Judenpolitik ermöglichte und erforderte, die Kennzeichnung und damit Aussonderung der jüdischen Menschen zu vollenden. Die als Idee beim Angeklagten schon lange vorhandene und durch umfangreiche Ausarbeitungen seit Februar 1938 in Entwürfen vorbereitete zwangsweise Beilegung jüdischer Vornamen wurde mit der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 17.August 1938 (RGBl. I S.1044) auf gesetzliche Grundlage gestellt. Nach §1 durften Juden nur solche Vornamen beigelegt werden, die in einem vom Reichsminister des Innern herausgegebenen Verzeichnis aufgeführt waren. Soweit jüdische Bürger andere als die in dem Verzeichnis enthaltenen Vornamen führten, wurden sie mit §2 der Zweiten Durchführungsverordnung gezwungen, ab 1.Januar 1939 einen weiteren Vornamen 103
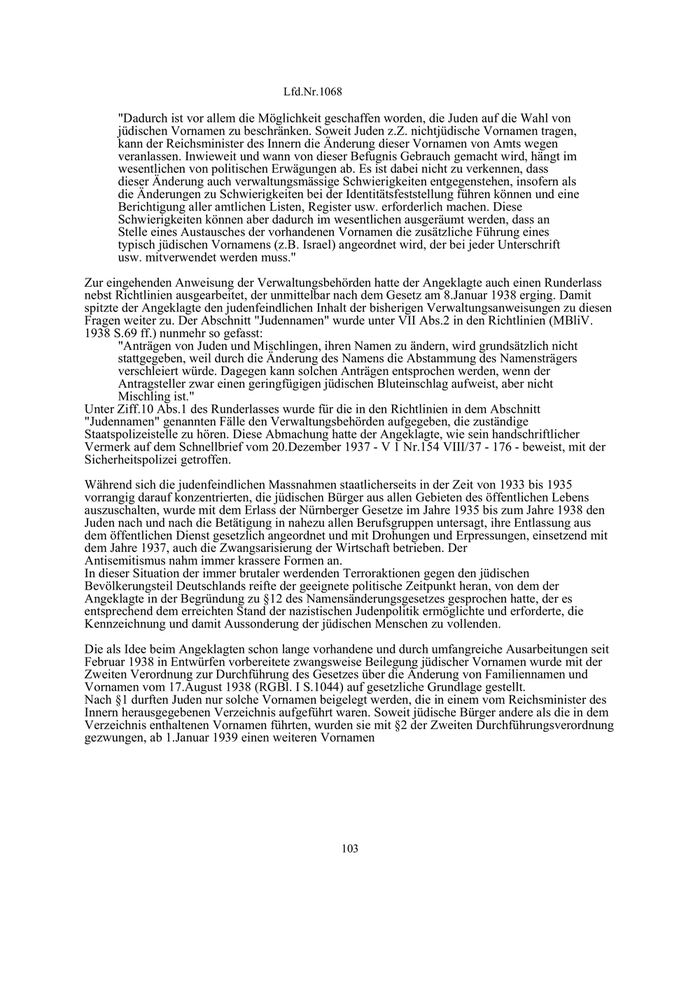
Lfd.Nr.1068 anzunehmen, und zwar mussten sich weibliche Personen zusätzlich "Sara" und männliche "Israel" nennen. Diese Vornamen mussten nach §3 auch im Rechts- und Geschäftsverkehr geführt werden. Für Zuwiderhandlungen wurden gemäss §4 Gefängnis- und Geldstrafen angedroht. Schon am nächsten Tage, dem 18.August 1938, erging der vom Angeklagten verfasste Runderlass 1 d 42 X/38-5501b (Sonderdruck Nr.63 MBliV. 1938 S.1345 ff.), mit dem die Verwaltungsbehörden unter Ziff.15 folgendermassen angewiesen wurden: "Eine Vornamensänderung ist regelmässig nur dann zu widerrufen, wenn sie von einem Juden zur Verschleierung seiner jüdischen Abstammung beantragt worden ist; insbesondere also, wenn ein in der Anlage aufgeführter Vorname durch einen anderen ersetzt worden ist." Als Anlage zu diesem Runderlass wurde ein Verzeichnis derjenigen jüdischen Vornamen herausgegeben, die von jüdischen Personen geführt werden durften. Mit dem vom Angeklagten ausgearbeiteten Runderlass vom 19.Dezember 1938 (MBliV. S.2193/94) wurden die Richtlinien für die Bearbeitung der Anträge auf Änderung des Familiennamens - Anlage zum Runderlass vom 8.Januar 1938 (MBliV. S.69) - unter Abschnitt VII Abs.2 (Judennamen) wie folgt geändert: "(2) Anträgen von Juden und Mischlingen 1.Grades, ihren Namen zu ändern, wird grundsätzlich nicht stattgegeben. Dagegen kann solchen Anträgen von Mischlingen zweiten Grades und von Personen mit geringfügigem jüdischen Bluteinschlag entsprochen werden." Am 24.Dezember 1940 (RGBl. I S.1669) erging die Dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. Mit ihr wurde die nach §7 des Namensänderungsgesetzes mit dem 31.Dezember 1940 ablaufende Widerrufsfrist bis zum 31.Dezember 1942 verlängert. Der Angeklagte gab hierzu im Kommentar Pfundtner/Neubert I Öffentliches Recht b) Verwaltung im Februar 1941 folgende Begründung: "Die Fristverlängerung war erforderlich, weil nach dem Runderlass des Reichsministers des Innern vom 20.10.1939 (MBliV. S.2182) wegen der Kriegsverhältnisse bis auf weiteres Verfahren auf Widerruf von Namensänderungen nicht durchgeführt werden." Da es die kriegsbedingte Einschränkung der Verwaltungsarbeit nicht ermöglichte, alle "unerwünschten" Namensänderungen bis zum 31.Dezember 1940 rückgängig zu machen, musste nach Meinung des Angeklagten daher die Möglichkeit geschaffen werden, diese Aktion zu gegebener Zeit weiterzuführen. Die vom Angeklagten entscheidend beeinflusste Grundlinie des Namensänderungsgesetzes, mit dem, ausser den unmittelbar damit geregelten Fällen, im weitesten Sinne angestrebt wurde, die jüdischen Bürger an ihren Namen kenntlich zu machen, fand, wie der Fall des Bürgers Deutsch zeigt, bei den Verwaltungsbehörden die entsprechende Resonanz. Der Regierungspräsident zu Köln richtete am 11.August 1939 an den Reichsminister des Innern folgendes Schreiben: "Ein in meinem Bezirk wohnender Jude, der den Familiennamen 'Deutsch' führt und dem die Führung dieses Namens im Wege des Widerrufs einer früheren Namensänderung nicht untersagt werden kann, ist aufgefordert worden, einen Antrag auf Änderung seines Familiennamens zu stellen. Der Jude weigert sich, dieser Aufforderung nachzukommen. Ich bitte um Entscheidung, was in dieser Sache veranlasst werden soll." Der Angeklagte als verantwortlicher Referent wandte sich in dieser Angelegenheit am 8.September 1939 - I d D 33/39.5515 - an das Hauptamt Sicherheitspolizei. Unter Schilderung des Sachverhalts bat er um Prüfung, ob seitens dieser Stelle "die Möglichkeit besteht", den Juden Deutsch zu veranlassen, einen Antrag auf Namensänderung zu stellen. Wörtlich hiess es dann: 104
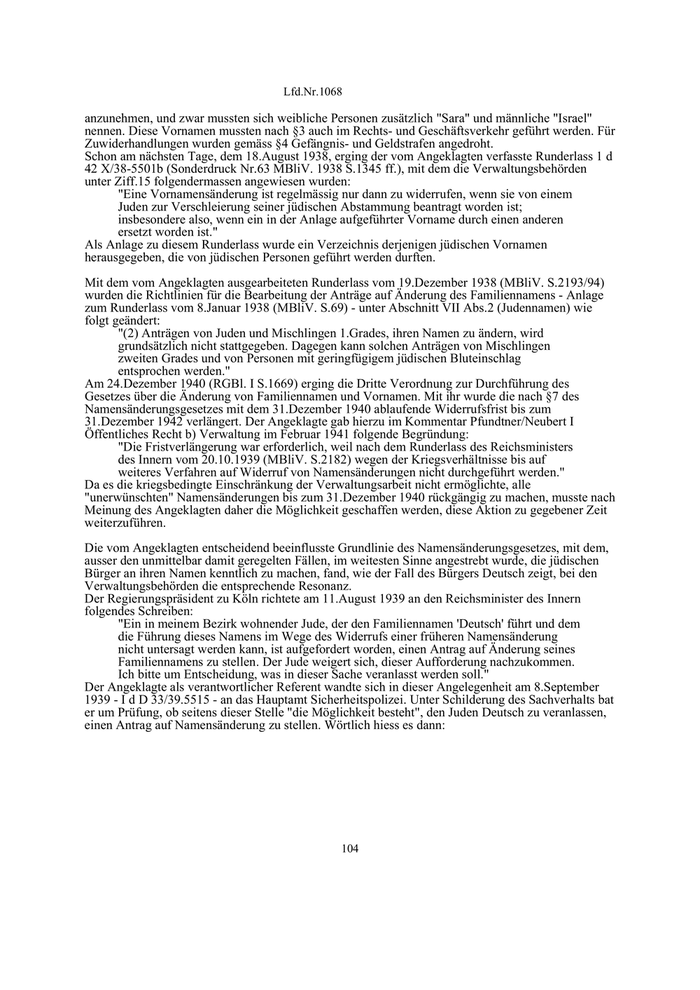
Lfd.Nr.1068 "Es ist erwünscht, dass der Jude einen Familiennamen beantragt, der seine Abstammung unzweifelhaft erkennen lässt." Da dem Angeklagten völlig klar war, dass es eine gesetzliche Handhabe nicht gab, den betreffenden Bürger gegen seinen Willen zu einem Namenswechsel zu bringen, überantwortete er ihn der für ihre brutalen Methoden berüchtigten Sicherheitspolizei. Im Februar 1941 kommentierte der Angeklagte das Namensänderungsgesetz und seine drei Durchführungsverordnungen in Pfundtner/Neubert I Öffentliches Recht b) Verwaltung. In der Einführung hob er die nach seiner Meinung zwei wesentlichen Neuerungen dergestalt hervor: "Einmal ist die Möglichkeit eines Widerrufs unerwünschter Namensänderungen, die in der Zeit vor dem 30.1.1933 genehmigt worden sind, vorgesehen. Sodann ist ein Namensfeststellungsverfahren geschaffen worden: der Reichsminister des Innern kann in Fällen, in denen es zweifelhaft ist, welchen Namen jemand zu führen berechtigt ist, diesen Namen mit allgemein verbindlicher Wirkung feststellen." Im einzelnen führt er dann zu §7 aus: "1. Eine zeitliche Grenze nach rückwärts ist nicht vorgesehen. Es kann daher jede Namensänderung widerrufen werden, die genehmigt worden ist, seitdem die willkürliche Namensänderung verboten worden war. 2. ... 3. Die durch §7 neu geschaffene Möglichkeit, vor dem 30.1.1933 genehmigte Namensänderungen zu widerrufen, wenn sie als unerwünscht anzusehen sind, bildet insbesondere die Rechtsgrundlage dafür, die Änderung jüdischer Namen rückgängig zu machen, wenn sie zur Verschleierung der jüdischen Abstammung dienen sollte." Durch Verordnung vom 24.Januar 1939 (RGBl. I S.81) wurde der Geltungsbereich des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 5.Januar 1938 und seiner beiden Durchführungsverordnungen vom 7.Januar und 17.April 1938 auch auf das Land Österreich und die sudetendeutschen Gebiete ausgedehnt. Auch hier war der Angeklagte der verantwortliche Bearbeiter, und "seine Mitarbeit bei der Wiedervereinigung Österreichs" wurde von Frick bei seinem Vorschlag an den Stellvertreter des Führers vom 25.April 1938, den Angeklagten zum Ministerialrat zu befördern, besonders anerkennend hervorgehoben. Der Angeklagte begnügte sich nicht mit der verantwortlichen Bearbeitung der Einführung der gesetzlichen Vorschriften des Namensänderungsrechts in Österreich und dem Sudetenland. Er arbeitete dazu noch einen Runderlass aus, mit dem am 2.Februar 1939 (MBliV. S.253) in diesen Gebieten die gesamten Verwaltungsvorschriften des R.u.Pr.MdI, darunter auch die Richtlinien über die Judennamen, eingeführt wurden. Der Angeklagte traf aber, bevor die Namensrechtsbestimmungen in Österreich eingeführt waren - mithin ohne gesetzliche Grundlage -, in seinem Arbeitsbereich Entscheidungen, die dem späteren Zustand vorgriffen, und liess damit erkennen, dass er die betreffenden Fragen nur in diesem Sinne geregelt wissen wollte. So wandte sich am 11.November 1938 das Auswärtige Amt an den Reichsminister des Innern mit der Bitte um Auskunft, wie die Ausstellung von Reisepässen für österreichische Juden zu handhaben sei. Der Angeklagte entschied diese Frage am 28.November 1938 (das Namensänderungsrecht ist am 24.Januar 1939 auf Österreich übertragen worden!) mit Schreiben an das Auswärtige Amt wie folgt: "Die Einführung des im Altreich geltenden Namensrechts einschliesslich der 2.VO zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 17.8.1938 (RGBl. I S.1044) im Lande Österreich ist für die nächste Zeit in Aussicht genommen. Ich habe keine Bedenken, dass bei der 105
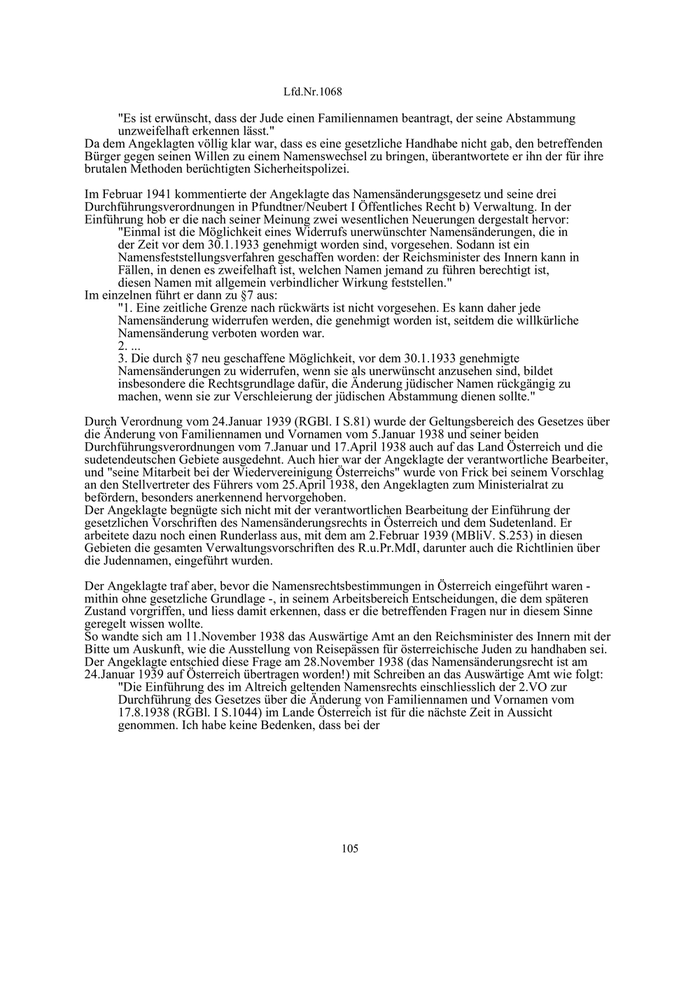
Lfd.Nr.1068 Ausstellung neuer Reisepässe für Juden vormals österreichischer Staatsangehörigkeit schon jetzt die zusätzlichen Vornamen eingetragen werden." In einem weiteren Fall richtete der Rechtsanwalt Dr. Paul Endlich, Berlin W 9, Tirpitzufer 26, am 1.September 1938 eine Anfrage an den Reichs- und Preussischen Minister des Innern, die der Angeklagte als zuständiger Referent zu bearbeiten hatte. Rechtsanwalt Dr. Endlich wies darauf hin, dass nach Artikel II des Gesetzes über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich vom 13.März 1938 (RGBl. I S.237) das in Österreich geltende Recht so lange in Kraft bleibe, bis das Reichsrecht eingeführt werde. Das treffe mithin auch für das Namensrecht zu. Nach seiner Meinung dürfte demnach die Pflicht zur zusätzlichen Namensführung, wie sie sich aus der 2.Durchführungsverordnung zum Namensänderungsgesetz vom 17.August 1938 ergebe, für im Ausland und im Altreich lebende Juden ehemals österreichischer Staatsangehörigkeit ebenfalls nicht bestehen. Rechtsanwalt Dr. Endlich bat, da mehrere diesbezügliche Anfragen bei ihm vorlägen, um Auskunft, ob seine Auslegung richtig sei. Hierauf wurde Rechtsanwalt Dr. Endlich unter dem 11.September 1938 - I d 84/5515b - mitgeteilt: "Das Reichsgesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 5.1.1938 (RGBl. I S.9) wird demnächst auch auf das Land Österreich ausgedehnt werden. Damit erledigt sich die vorbezeichnete Anfrage." Damit gab sich Rechtsanwalt Dr. Endlich nicht zufrieden. Er machte am 14.Dezember 1938 eine erneute Eingabe, mit der er sein Anliegen noch dahin konkretisierte, dass sein im Altreich lebender Mandant so lange die österreichische Staatsangehörigkeit gehabt und zur Zeit einen Antrag bei der Reichsstelle für Sippenforschung laufen habe, mit dem er den Nachweis anstrebe, dass er arischer Abstammung sei. Darauf entgegnete der Angeklagte in einem von ihm unterzeichneten Schreiben vom 7.Januar 1939 - I d 84 IV / 5515b - nochmals, dass die Einführung des im Altreich geltenden Namensrechtes im Lande Österreich zu erwarten sei. Zu dem von Rechtsanwalt Dr. Endlich vorgetragenen konkreten Fall nahm er folgendermassen Stellung: "Die Tatsache, dass jemand, der nach den vorhandenen Urkunden als Jude einzuordnen ist, aus irgendwelchen Gründen gleichwohl seine Judeneigenschaft nicht als gegeben ansieht, rechtfertigt eine befristete Befreiung von den Verpflichtungen nach §§2 und 3 der 2.Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 17.August 1938 (RGBl. I S.1044) regelmässig nicht. Nur in besonders liegenden Ausnahmefällen erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Zusatzname vorläufig nicht geführt wird. Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Stand der von der Reichsstelle für Sippenforschung angestellten Ermittlungen die An- nahme zulässt, dass die Angaben des Antragstellers über seine nicht volljüdische Abstammung mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffen." Obwohl es im vorliegenden Fall schon an sich keine gesetzliche Bestimmung gab, auf jüdische Personen österreichischer Staatszugehörigkeit die Namensrechtsvorschriften des Deutschen Reiches anzuwenden, setzte sich der Angeklagte nicht nur hierüber, sondern auch über den Umstand hinweg, dass noch nicht einmal mit Gewissheit feststand, ob die betreffende Person ganz oder teilweise jüdischer Abstammung war. Auch in diesem Falle wollte der Angeklagte, wie er eigenhändig zu Papier gebracht hatte, nicht einmal die Entscheidung der Reichsstelle für Sippenforschung abwarten; vielmehr machte er es auch Personen mit durchaus noch nicht geklärter Abstammung zur Pflicht, die zusätzlichen Vornamen Sara und Israel zu führen. 106