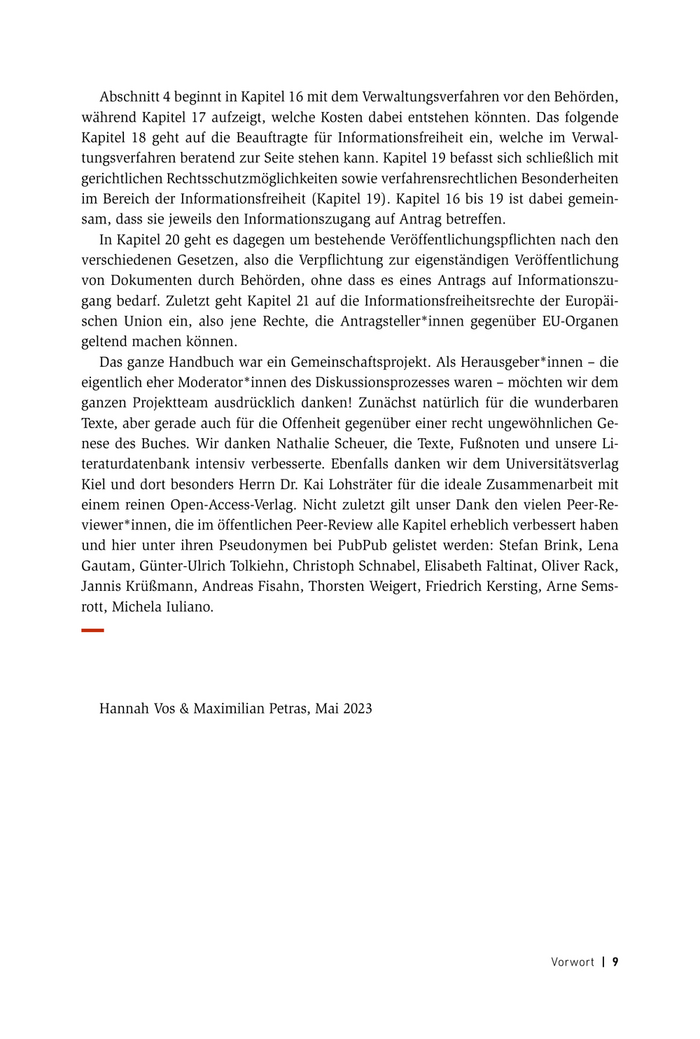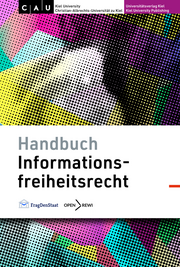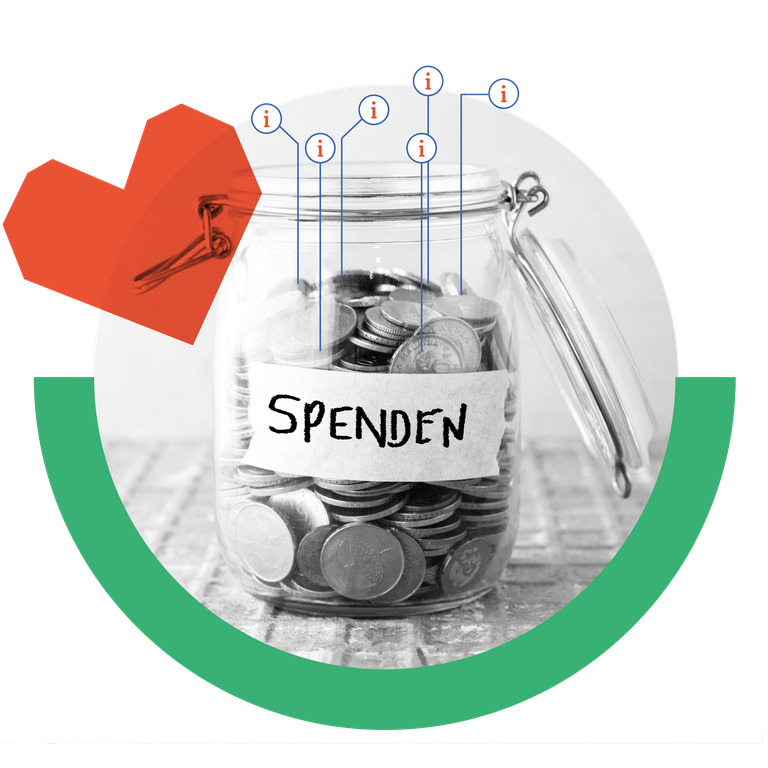Wir haben ein Handbuch für die Informationsfreiheit geschrieben
Frei zugängliche rechtswissenschaftliche Literatur im Bereich der Informationsfreiheit gibt es bisher so gut wie nicht. Das erschien uns paradox. Also haben wir ein Handbuch geschrieben.
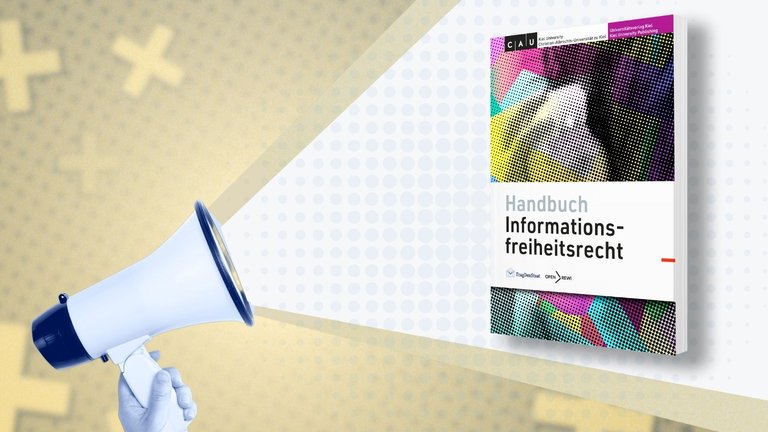
Im Mai letzten Jahres haben wir gemeinsam mit OpenRewi, einer Initiative für offene Rechtswissenschaft, das Projekt „Handbuch Informationsfreiheitsrecht“ gestartet. Aus unserem Aufruf zur Mitarbeit ist ein Team von 13 Autor*innen aus Rechtswissenschaft und Praxis entstanden. Unser Ziel: Einen gut verständlichen und praxistauglichen Überblick des Informationsfreiheitsrechts in Deutschland zu schaffen. Und zwar nicht nur für die, die es sich leisten können, sondern für alle. All unsere Autor*innen haben relevante Rechtsprechung und Stimmen aus der Literatur ausgewertet und im Handbuch aufbereitet. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Buch nicht von den „klassischen“ rechtswissenschaftlichen Kommentaren. Aufbau und Sprache des Buches haben wir aber so gewählt, dass nicht nur Jurist*innen, sondern darüber hinaus alle mit dem Buch etwas anfangen und es für ihre Zwecke nutzen können.
Warum das für dich nützlich ist
Das Informationsfreiheitsrecht in Deutschland ist unübersichtlich. Es gibt eine Vielzahl von Bundes- und Ländergesetzen und einige kommunale Satzungen. Die Gesetze folgen jedoch einer ähnlichen Struktur und sie verwenden häufig identische oder jedenfalls ähnliche Begriffe. Unser Handbuch orientiert sich deswegen nicht an einzelnen Paragraphen, sondern an Themengebieten. Wenngleich ein Schwerpunkt auf dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) liegt, ist es damit nicht nur für Anträge nach dem IFG, sondern auch für Anträge nach anderen Gesetzen nutzbar.
Wir als Legal-Team von FragDenStaat haben in den vergangenen Jahren immer wieder rechtlich geprüft, warum Behörden Informationsfreiheitsanträge ablehnen. Welche Argumente bringen Behörden? Wann lohnt es sich zu klagen?
Unsere Beobachtungen und Erfahrungen geben wir im Handbuch unter anderem in vielen Praxistipps für Antragsteller*innen weiter.
Wie das Buch entstanden ist
Das Buch ist ein Gemeinschaftswerk. Die einzelnen Kapitel wurden zunächst jeweils von Co-Autor*innen in einem Peer-Review-Prozess geprüft . Anschließend haben wir PrePrints bei PubPub veröffentlicht und dazu aufgerufen, die Kapitel zu kommentieren. An der öffentlichen Peer-Review haben sich viele kluge Menschen beteiligt, deren Anmerkungen das Buch verbessert haben. Die (vorläufig) finale Version des Buches ist nun beim Universitätsverlag Kiel sowohl online als auch in gedruckter Form erschienen.
Das Buch soll aktualisiert und fortentwickelt werden. Auf PubPub wird es weiterhin die Möglichkeit geben, zu kommentieren und wir freuen uns über Feedback.
Vor allem hoffen wir, dass das Buch einen Beitrag zu vielen erfolgreichen IFG-Anträgen leisten wird!
Universitätsverlag Kiel
Kiel University Publishing
Handbuch
Informations-
freiheitsrecht

Handbuch Informations- freiheitsrecht Herausgegeben von Maximilian Petras und Hannah Vos Bearbeitet von Layla Ansari • Stella Dörenbach • Lorenz Dudew • Anna Gilsbach • Katharina Goldberg • Vivian Kube • Niels Lötel • Marco Mauer • Maximilian Petras • Laura Pick • Sebastian Sudrow • Hannah Vos • David Werdermann
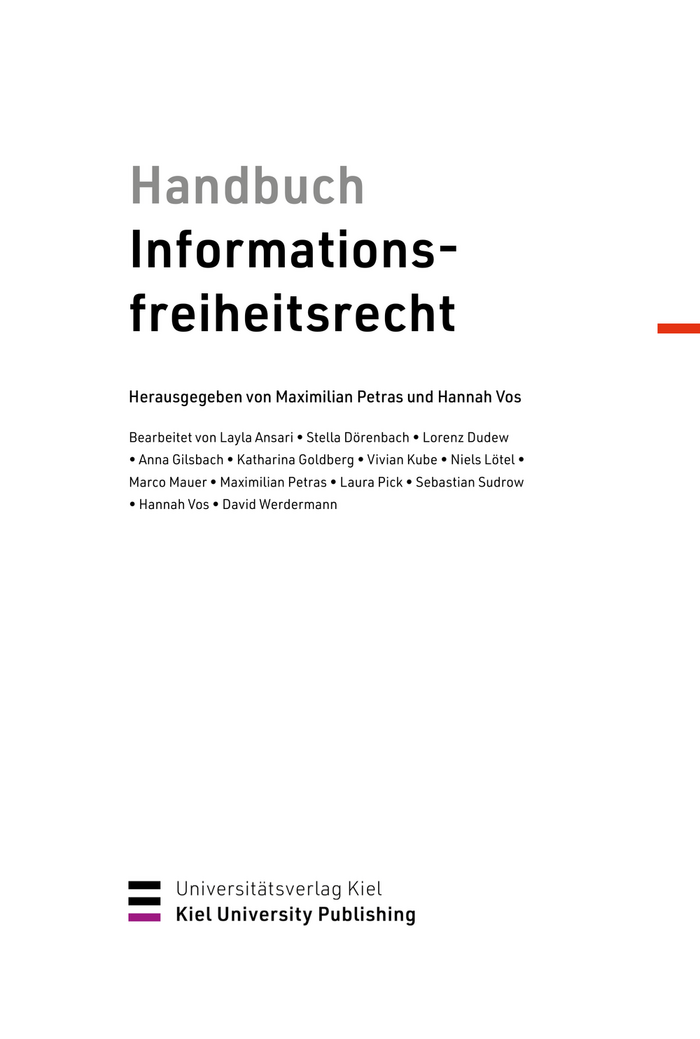
HERAUSGEBER*INNEN Hannah Vos , Open Knowledge Foundation Deutschland e.V., Singerstr. 109, 10179 Berlin, hannah.vos@okfn.de Maximilian Petras , Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg, petrasm@hsu-hh.de (vormals Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) Eine Kooperation von: Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliographische Daten sind über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Open Access Das Werk ist unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International veröffentlicht. Den Vertragstext finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/ by-sa/4.0. Bitte beachten Sie, dass einzelne, entsprechend gekennzeichnete Teile des Werks von der genannten Lizenz ausgenommen sein bzw. anderen urheberrechtlichen Bedingungen unterliegen können. Die elektronische Ausgabe des Werks ist auf dem Open-Access-Publikationsserver MACAU der Universitäts- bibliothek Kiel (https://macau.uni-kiel.de) frei verfügbar: https://doi.org/10.38072/978-3-910591-01-1. 2023 Universitätsverlag Kiel | Kiel University Publishing Universitätsbibliothek Kiel Leibnizstr. 9 24118 Kiel Deutschland verlag@ub.uni-kiel.de, www.universitaetsverlag.uni-kiel.de Umschlaggestaltung und Satz: Wiebke Buckow Druck und Bindung: CPI books GmbH, Ferdinand-Jühlke-Straße 7, 99095 Erfurt Titelbild: Stella Schiffczyk, veröffentlicht unter der Lizenz CC BY 4.0. ISBN (Print): 978-3-910591-02-8 eISBN (PDF): 978-3-910591-01-1
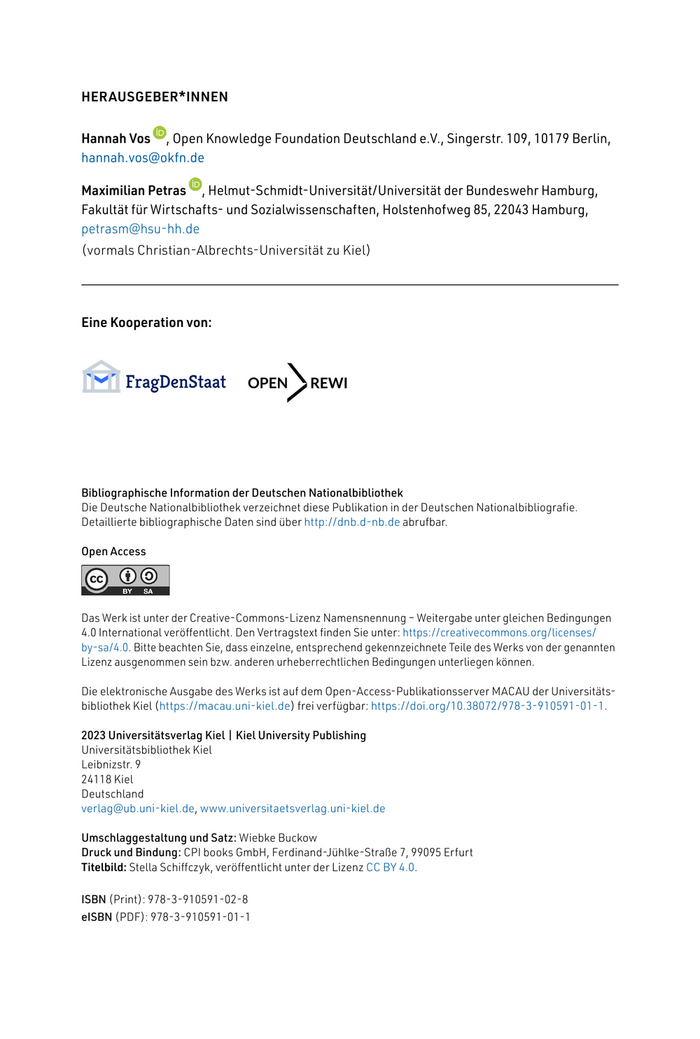
INHALT
Vorwort der Herausgeber*innen 7
Hannah Vos
Einleitung ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
1. GRUNDLAGEN ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Maximilian Petras
Unsichtbare Infrastrukturen ����������������������������������������������������������������������������������� 33
Anna Gilsbach
Die Informationsfreiheit in der Europäischen Menschenrechtskonvention ����������� 53
Layla Ansari
Die Informationsfreiheit in der Aarhus-Konvention ����������������������������������������������� 59
2. ANSPRUCHSINHALTE UND ADRESSATEN ������������������������������������������������ 71
Einführung: Anspruchsinhalte und Adressaten ������������������������������������������������������ 73
Vivian Kube
Amtliche Informationen ������������������������������������������������������������������������������������������ 75
Layla Ansari
Der Informationsbegriff nach den Umweltinformationsgesetzen �������������������������� 97
Hannah Vos
Der Informationsbegriff im VIG ����������������������������������������������������������������������������� 123
Sebastian Sudrow, Lorenz Dudew
Informationspflichtige Stellen ������������������������������������������������������������������������������ 135
3. ABLEHNUNGSGRÜNDE ��������������������������������������������������������������������������������� 167
Einführung: Ablehnungsgründe ��������������������������������������������������������������������������� 169
3.1 ÖFFENTLICHE BELANGE
Niels Lötel
Besondere öffentliche Interessen ����������������������������������������������������������������� 171
Laura Pick
Geheimnisschutzvorschriften ����������������������������������������������������������������������� 189
Laura Pick
Öffentliche Sicherheit ������������������������������������������������������������������������������������ 207
Vivian Kube, Hannah Vos, David Werdermann
Verfahrensbezogene Ablehnungsgründe ������������������������������������������������������ 221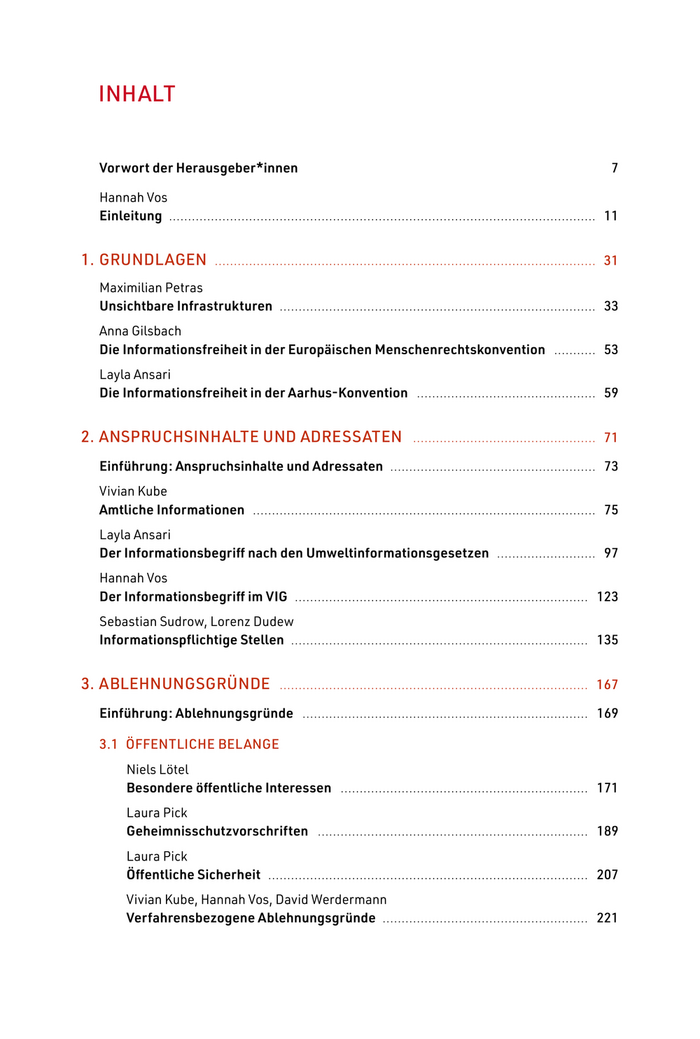
3.2 PRIVATE & SONSTIGE BELANGE
Niels Lötel
Schutz personenbezogener Daten ���������������������������������������������������������������� 253
Niels Lötel
Schutz des geistigen Eigentums
und von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen ������������������������������������������ 283
Anna Gilsbach, Hannah Vos
Weitere Ablehnungsgründe ��������������������������������������������������������������������������� 297
4. VERFAHREN ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 307
Anna Gilsbach, Hannah Vos
Verfahren �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 309
Lorenz Dudew, Hannah Vos
Kosten ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 353
Katharina Goldberg
Beauftragte für die Informationsfreiheit �������������������������������������������������������������� 371
Vivian Kube, David Werdermann
Rechtsschutz �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 381
5. VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN ����������������������������������������������������������� 417
Stella Dörenbach
Veröffentlichungspflichten ����������������������������������������������������������������������������������� 419
6. ZUGANG ZU DOKUMENTEN DER EUROPÄISCHEN UNION ����������������� 431
Marco Mauer
Zugang zu Dokumenten der Europäischen Union ������������������������������������������������� 433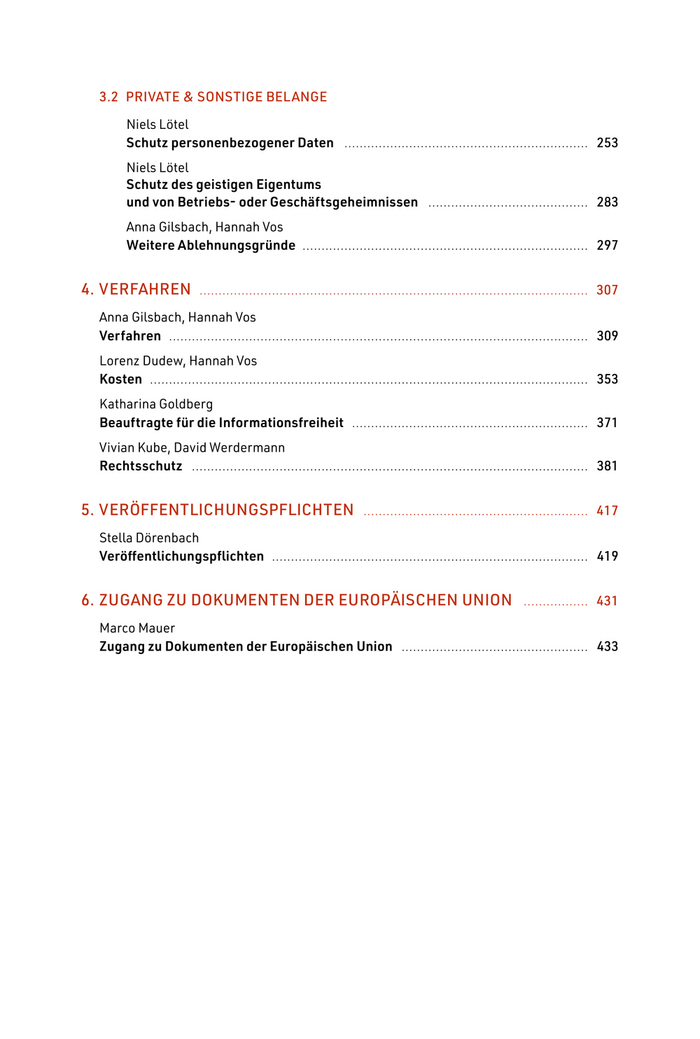
Maximilian Petras, Hannah Vos
Vorwort der Herausgeber*innen
Rechtswissenschaftliche Literatur zum Informationsfreiheitsrecht sollte frei zu-
gänglich sein. Es erschien uns merkwürdig, dass dies bisher kaum der Fall ist. So
entstand die Idee einer Kooperation zwischen FragDenStaat und OpenRewi. Frag-
DenStaat widmet sich als Transparenzportal dem Anliegen, dass alle Menschen ihre
Informationszugangsansprüche so niedrigschwellig und effektiv wie möglich wahr-
nehmen können und befreite Informationen für alle zugänglich und nutzbar sind.
Die Ansprüche der Nutzer*innen des Portals werden dabei notfalls auch gerichtlich
durchgesetzt und Gerichtsurteile zur Fortbildung der Informationsfreiheit erstritten.
OpenRewi arbeitet an der Öffnung der deutschen Rechtswissenschaft. Diese findet
ganz überwiegend hinter Paywalls statt. Das wollen wir ändern, indem unsere Texte
frei lizenziert und kooperativ erstellt werden.
Das hier vorliegende erste, frei lizenzierte Handbuch im Informationsfreiheitsrecht
hat den Anspruch, einen ersten Zugang zur Materie zu bieten und an einigen Stel-
len – teilweise durchaus kritisch – in die Tiefe zu gehen. Die Autor*innen vereint
eine gewisse Sympathie für die Öffnung staatlicher (und privater) Informationsbe-
stände, zugleich sollen die Texte aber eine verlässliche rechtliche Orientierung für In-
formationssuchende sein. Das Handbuch ist objektiv in der Darstellung, aber ergreift
auch Partei. Unsere Kapitel sind ein von der Praxis inspirierter Beitrag zur rechts-
wissenschaftlichen Diskussion. Dementsprechend sind in unserem Team sowohl An-
wält*innen als auch Rechtswissenschaftler*innen vertreten. Dem Anspruch gerecht
zu werden, sowohl für Nicht-Jurist*innen als auch rechtswissenschaftlich geschulte
Leser*innen zu schreiben, ist aufgrund der zahlreichen juristischen Fachbegriffe im-
mer eine Gratwanderung. Je mehr frei zugängliche Projekte es bei OpenRewi gibt,
desto einfacher wird es in Zukunft sein, Fachbegriffe zu verlinken. Für den Moment
haben wir uns darum bemüht, abstrakte Ausführungen immer mit konkreten Praxis-
tipps anschaulicher zu machen.
Alle Texte wurden gemeinsam diskutiert, sowohl intern im Team, als auch über ein
öffentliches Peer-Review Verfahren, bei dem zahlreiche Leser*innen aus Wissenschaft
und Praxis ihr Feedback hinterlassen haben. Das Handbuch wird ergänzt durch eine
ebenfalls frei zugängliche, dynamisch durchsuchbare Literaturdatenbank. Zugleich
sind die Kapitel ein Aufruf, sie weiter zu kommentieren und weiterzuverwenden:
| 7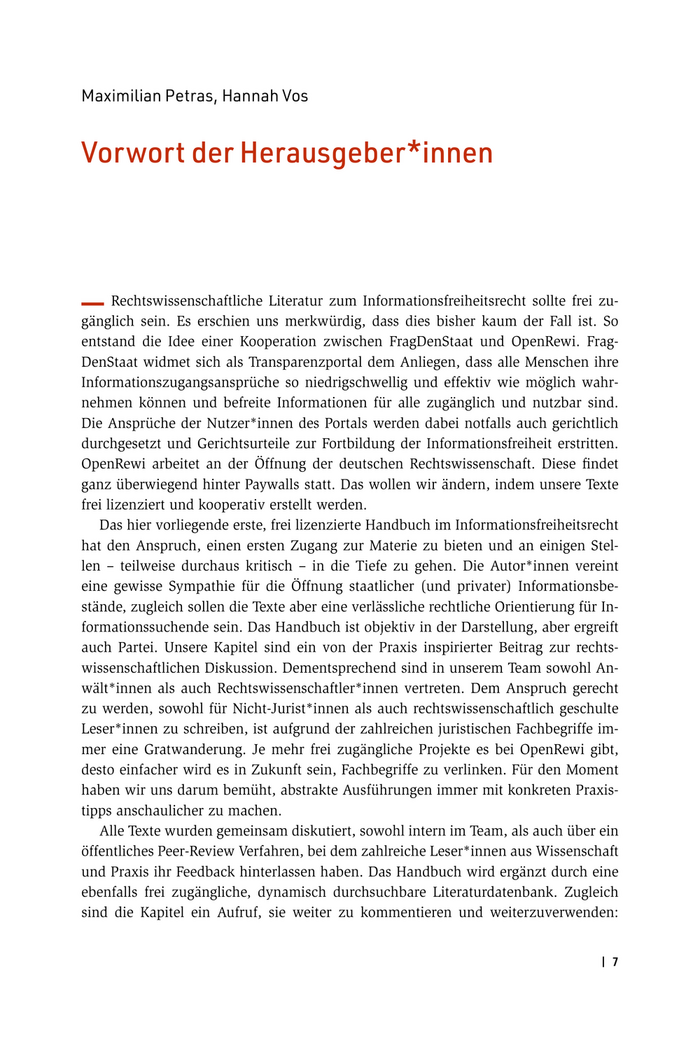
aufgrund der freien Creative-Commons-Lizenz (CC-BY-SA) ist das ohne Probleme
möglich. Wir haben uns mit Absicht gegen die starre Form eines juristischen Kom-
mentars entschieden, um die einzelnen, frei zusammengesetzten Kapitel des Hand-
buches in Zukunft flexibel zu verbessern. Deshalb wünschen wir uns intensives Feed-
back von allen Leser*innen zu dem Konzept des Buches oder den einzelnen Kapiteln.
Das Handbuch enthält Ausführungen zu allen Gesetzen, die als Informationszu-
gangsgesetze im engeren Sinn verstanden werden können. Dies sind im Einzelnen das
Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, das Umweltinformationsgesetz des Bundes
bzw. der Bundesländer, das Verbraucherinformationsgesetz und die Informationsfrei-
heits- bzw. Transparenzgesetze der Bundesländer.1 Die Abschnitte und Kapitel sind
nicht nach Gesetzen, sondern nach Themenkomplexen unterteilt. Praktische Erfah-
rungen und Statistiken von FragDenStaat sind dabei in unterschiedlichem Umfang in
die einzelnen Kapitel eingeflossen.
Im ersten Abschnitt des Handbuches werden die Grundlagen gelegt. Kapitel eins
gibt einen allgemeinen Überblick zu Rechtslage und Praxis. Das zweite Kapitel nimmt
die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Informationsfreiheitsrechts aus einer neu-
en, infrastrukturellen Perspektive in den Blick. Kapitel drei schaut auf Art. 10 der
europäischen Menschenrechtskonvention und Kapitel vier ergänzt die völkerrecht-
lichen Grundlagen aus der Sicht des Umweltinformationsfreiheitsrechts.
Danach will Abschnitt zwei des Handbuches klären, was eigentlich Informationen
nach den verschiedenen Rechtsgrundlagen sind und wer sie herausgeben muss. Kapi-
tel 5 bis 7 erläutern die Begriffe amtliche Information (Kapitel 5), Umweltinformation
(Kapitel 6) und Verbraucherinformation (Kapitel 7). Wer in Bezug auf welche Infor-
mationen und unter welchen Voraussetzungen informationspflichtige Stelle ist, wird
anschließend in Kapitel 8 dargestellt.
Die Grundprämisse des Informationsfreiheitsrechts ist klar: »Jeder hat nach Maß-
gabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang
zu amtlichen Informationen«, heißt es etwa in § 1 Abs. 1 S. 1 IFG. Die Konflikte liegen
insbesondere bei den zahlreichen Ablehnungsgründen, nach denen die Informationen
wiederum doch nicht herausgegeben werden müssen. Verschiedene Kategorien über-
schneiden sich häufig – was zugleich einer von vielen immer wieder geäußerten Kritik-
punkten an den Ablehnungsgründen ist. Das gilt besonders im Bereich der öffentlichen
Belangen dienenden Ablehnungsgründe (Kapitel 9-12). Aber auch die Interessen priva-
ter Dritter können die Herausgabe verhindern (Kapitel 13, 14).
Schließlich gibt es weitere ›allgemeine‹ Ablehnungsgründe, die in den Informa-
tionsfreiheitsgesetzen selbst oftmals gar nicht oder nicht ausdrücklich als solche kodi-
fiziert sind (Kapitel 15).
1 Darüber hinaus ist dem Informationszugang auf EU-Ebene nach der VO 1049/2001 ein eigenes Kapitel
gewidmet.
8 | Handbuch Informationsfreiheitsrecht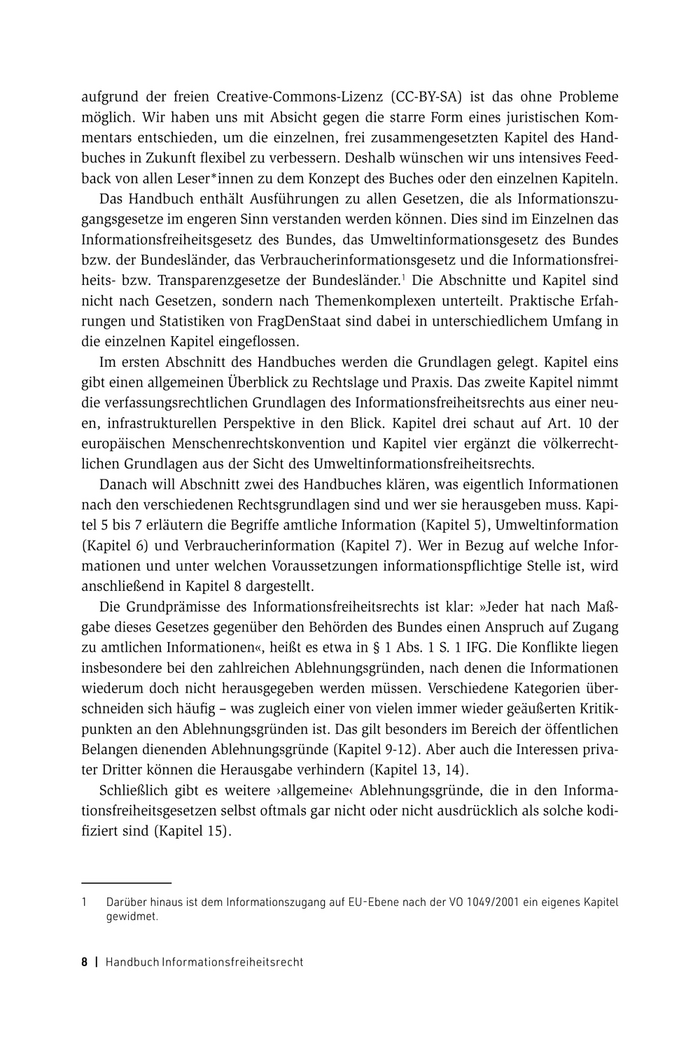
Abschnitt 4 beginnt in Kapitel 16 mit dem Verwaltungsverfahren vor den Behörden,
während Kapitel 17 aufzeigt, welche Kosten dabei entstehen könnten. Das folgende
Kapitel 18 geht auf die Beauftragte für Informationsfreiheit ein, welche im Verwal-
tungsverfahren beratend zur Seite stehen kann. Kapitel 19 befasst sich schließlich mit
gerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten sowie verfahrensrechtlichen Besonderheiten
im Bereich der Informationsfreiheit (Kapitel 19). Kapitel 16 bis 19 ist dabei gemein-
sam, dass sie jeweils den Informationszugang auf Antrag betreffen.
In Kapitel 20 geht es dagegen um bestehende Veröffentlichungspflichten nach den
verschiedenen Gesetzen, also die Verpflichtung zur eigenständigen Veröffentlichung
von Dokumenten durch Behörden, ohne dass es eines Antrags auf Informationszu-
gang bedarf. Zuletzt geht Kapitel 21 auf die Informationsfreiheitsrechte der Europäi-
schen Union ein, also jene Rechte, die Antragsteller*innen gegenüber EU-Organen
geltend machen können.
Das ganze Handbuch war ein Gemeinschaftsprojekt. Als Herausgeber*innen – die
eigentlich eher Moderator*innen des Diskussionsprozesses waren – möchten wir dem
ganzen Projektteam ausdrücklich danken! Zunächst natürlich für die wunderbaren
Texte, aber gerade auch für die Offenheit gegenüber einer recht ungewöhnlichen Ge-
nese des Buches. Wir danken Nathalie Scheuer, die Texte, Fußnoten und unsere Li-
teraturdatenbank intensiv verbesserte. Ebenfalls danken wir dem Universitätsverlag
Kiel und dort besonders Herrn Dr. Kai Lohsträter für die ideale Zusammenarbeit mit
einem reinen Open-Access-Verlag. Nicht zuletzt gilt unser Dank den vielen Peer-Re-
viewer*innen, die im öffentlichen Peer-Review alle Kapitel erheblich verbessert haben
und hier unter ihren Pseudonymen bei PubPub gelistet werden: Stefan Brink, Lena
Gautam, Günter-Ulrich Tolkiehn, Christoph Schnabel, Elisabeth Faltinat, Oliver Rack,
Jannis Krüßmann, Andreas Fisahn, Thorsten Weigert, Friedrich Kersting, Arne Sems-
rott, Michela Iuliano.
Hannah Vos & Maximilian Petras, Mai 2023
Vorwort | 9